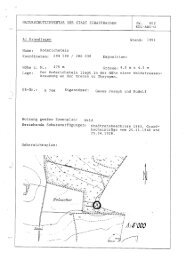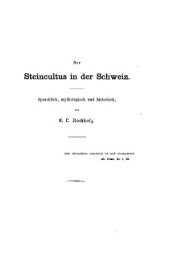Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...
Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...
Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
4 Zur Morphotektonik der zentralschweizerischen Alpenrandseen<br />
Zusammenfassung<br />
Bei der Betrachtung bevorzugter Richtungen in der<br />
Landschaft der Zentralschweiz wurde auf solche von<br />
Seen <strong>und</strong> ihren Zuflüssen <strong>und</strong> ihren Zusammenhang<br />
mit Klüften <strong>und</strong> Bruchstörungen, auf die Morphotektonik,<br />
geachtet: Bäche fliessen selten in der Falllinie in<br />
die Seen. Ein Vergleich der drei Richtungselemente hat<br />
ergeben:<br />
– Es gibt keine Korrelation zwischen den Richtungen<br />
der Seebecken <strong>und</strong> der Klüfte. Die beiden müssen<br />
daher unabhängig voneinander entstanden sein: Da<br />
die Klüfte nachweislich nach-miozänen Ursprungs<br />
sind, muss die Anlage der Seebecken durch die spätmiozäne<br />
Platznahme der Decken vorgezeichnet<br />
worden sein.<br />
– Es lässt sich keine Korrelation zwischen den Richtungen<br />
der Seebecken <strong>und</strong> der Zuflüsse erkennen.<br />
Die beiden dürften daher unabhängig voneinander<br />
entstanden sein.<br />
– Dagegen besteht eine Korrelation zwischen Kluft<strong>und</strong><br />
Bachrichtungen innerhalb der einzelnen Seen.<br />
Klüfte <strong>und</strong> Laufstrecken der Bäche sind daher<br />
durch dieselbe Ursache vorgezeichnet worden,<br />
durch die Wirkung des jüngeren, nach-miozänen,<br />
neo-tektonischen Spannungsfeldes.<br />
4.1 Einleitung<br />
Richtungsbeziehungen zwischen Gewässern (Seen, Bächen) <strong>und</strong> Klüften<br />
Die zentralschweizerischen Alpenrandseen bilden ein<br />
eindrucksvolles Merkmal <strong>und</strong> eine touristische Attraktion<br />
in der Landschaft. Zum Teil sind sie tief ins<br />
Gebirge eingebettet, wie der Urner See, zum Teil<br />
René Hantke, Adrian E. Scheidegger<br />
erscheinen sie weniger spektakulär, wandeln sich von<br />
rein alpiner Charakteristik zu Mittellandseen, wie der<br />
Zuger See. Durch den Bau von Staumauern wurden<br />
vormalige Seen wieder geschaffen, reaktiviert.<br />
– Im Molasse-Vorland: Ägerisee, Lauerzer <strong>und</strong> Zuger<br />
See,<br />
– die Arme des Vierwaldstätter Sees,<br />
– Seen der Obwaldner Talung: Alpnacher See,<br />
Wichelsee, Sarner <strong>und</strong> Lungerer See,<br />
– Stauseen: Klöntaler See, Wägitaler See <strong>und</strong> Sihlsee.<br />
HEIM (1894a) sah in der Entstehung der Alpenrandseen<br />
alte Flusstäler, die beim Einsinken des Alpenkörpers<br />
unter dessen Last ertrunken wären. Bis KOPP<br />
(1962a), oft noch später, wurden sie als Wirkung<br />
der Glazialerosion angesehen; HANTKE (1991 S.182)<br />
schreibt ihre Anlage der landschaftsgestaltenden Tektonik<br />
zu: klaffenden Grenzblättern (Urner See) <strong>und</strong><br />
Decken-Stirnen (Sarner See, Vitznauer <strong>und</strong> Gersauer<br />
Becken des Vierwaldstätter Sees), Aufbrüchen (Küssnachter<br />
Arm) <strong>und</strong> Scherstörungen in Spätphasen alpiner<br />
Gebirgsbildung (BUXTORF 1951).<br />
Sodann erhebt sich die Frage nach Beziehungen zwischen<br />
den Seen <strong>und</strong> ihrer Umgebung, zwischen den<br />
Seen <strong>und</strong> ihren Zuflüssen einerseits <strong>und</strong> Klüften <strong>und</strong><br />
Scherstörungen im Gestein anderseits. Es wird sich herausstellen,<br />
dass die Genese der Seen nicht direkt mit<br />
jener der Klüfte <strong>und</strong> jener der Zuflüsse zusammenhängt.<br />
4.2 Methodik der Studie<br />
Die Studie zielt auf eine Klärung der Morphotektonik des<br />
Umfeldes der Zentralschweizer Alpenrandseen. Dies<br />
Mio. Jahre<br />
vor heute<br />
Ära Abt. Stufen Molasse-Schichtabfolgen Gesteinsarten<br />
17–12 Karpat-Sarmat Obere Süsswassermolasse OSM Hörnli-Schuttfächer: Nagelfluh Sandstein, Mergel, Kalke, Kohlen<br />
22–17<br />
Helvetian<br />
Burdigalian<br />
Obere Meeresmolasse OMM<br />
Ufenauer- <strong>und</strong> St. Galler Sandstein,<br />
Luzerner- <strong>und</strong> Bächer Sandstein<br />
24–22 Aquitanian Höhronen- <strong>und</strong><br />
Untere Süsswassermolasse USM Rigi-Schuttfächer:<br />
29–24 Chattian Nagelfluh, Sandstein, Mergel, Kalke, Kohlen<br />
33–29 Rupelian Untere Meeresmolasse UMM<br />
Horwer Sandstein,<br />
Grisiger Mergel<br />
Mittleres KÄnozoikum<br />
(Mittlere Erdneuzeit)<br />
Oligozän Miozän<br />
Tab. 4.1 Gliederung der Zentral- <strong>und</strong> Ostschweizer Molasse<br />
83