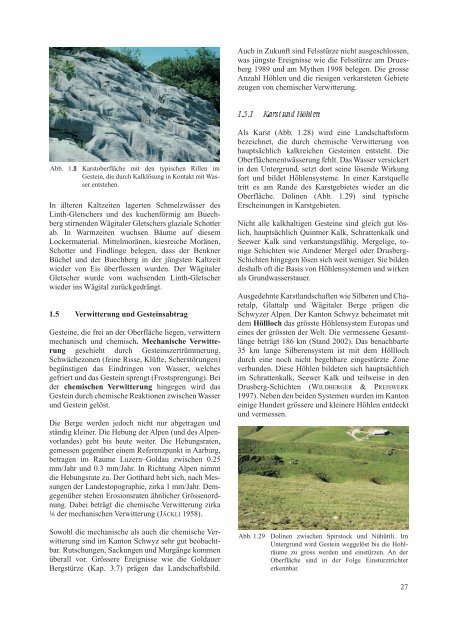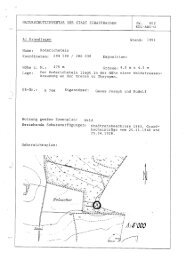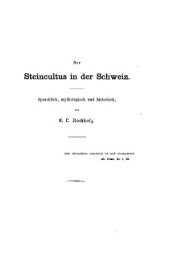Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...
Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...
Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Abb. 1.28 Karstoberfläche mit den typischen Rillen im<br />
Gestein, die durch Kalklösung in Kontakt mit Wasser<br />
entstehen.<br />
In älteren Kaltzeiten lagerten Schmelzwässer des<br />
Linth-Gletschers <strong>und</strong> des kuchenförmig am Buechberg<br />
stirnenden Wägitaler Gletschers glaziale Schotter<br />
ab. In Warmzeiten wuchsen Bäume auf diesem<br />
Lockermaterial. Mittelmoränen, kiesreiche Moränen,<br />
Schotter <strong>und</strong> Findlinge belegen, dass der Benkner<br />
Büchel <strong>und</strong> der Buechberg in der jüngsten Kaltzeit<br />
wieder von Eis überflossen wurden. Der Wägitaler<br />
Gletscher wurde vom wachsenden Linth-Gletscher<br />
wieder ins Wägital zurückgedrängt.<br />
1.5 Verwitterung <strong>und</strong> Gesteinsabtrag<br />
Gesteine, die frei an der Oberfläche liegen, verwittern<br />
mechanisch <strong>und</strong> chemisch. Mechanische Verwitterung<br />
geschieht durch Gesteinszertrümmerung.<br />
Schwächezonen (feine Risse, Klüfte, Scherstörungen)<br />
begünstigen das Eindringen von Wasser, welches<br />
gefriert <strong>und</strong> das Gestein sprengt (Frostsprengung). Bei<br />
der chemischen Verwitterung hingegen wird das<br />
Gestein durch chemische Reaktionen zwischen Wasser<br />
<strong>und</strong> Gestein gelöst.<br />
Die Berge werden jedoch nicht nur abgetragen <strong>und</strong><br />
ständig kleiner. Die Hebung der Alpen (<strong>und</strong> des Alpenvorlandes)<br />
geht bis heute weiter. Die Hebungsraten,<br />
gemessen gegenüber einem Referenzpunkt in Aarburg,<br />
betragen im Raume Luzern–Goldau zwischen 0.25<br />
mm/Jahr <strong>und</strong> 0.3 mm/Jahr. In Richtung Alpen nimmt<br />
die Hebungsrate zu. Der Gotthard hebt sich, nach Messungen<br />
der Landestopographie, zirka 1 mm/Jahr. Demgegenüber<br />
stehen Erosionsraten ähnlicher Grössenordnung.<br />
Dabei beträgt die chemische Verwitterung zirka<br />
1⁄6 der mechanischen Verwitterung (JÄCKLI 1958).<br />
Sowohl die mechanische als auch die chemische Verwitterung<br />
sind im <strong>Kanton</strong> <strong>Schwyz</strong> sehr gut beobachtbar.<br />
Rutschungen, Sackungen <strong>und</strong> Murgänge kommen<br />
überall vor. Grössere Ereignisse wie die Goldauer<br />
Bergstürze (Kap. 3.7) prägen das Landschaftsbild.<br />
Auch in Zukunft sind Felsstürze nicht ausgeschlossen,<br />
was jüngste Ereignisse wie die Felsstürze am Druesberg<br />
1989 <strong>und</strong> am Mythen 1998 belegen. Die grosse<br />
Anzahl Höhlen <strong>und</strong> die riesigen verkarsteten Gebiete<br />
zeugen von chemischer Verwitterung.<br />
Als Karst (Abb. 1.28) wird eine Landschaftsform<br />
bezeichnet, die durch chemische Verwitterung von<br />
hauptsächlich kalkreichen Gesteinen entsteht. Die<br />
Oberflächenentwässerung fehlt. Das Wasser versickert<br />
in den Untergr<strong>und</strong>, setzt dort seine lösende Wirkung<br />
fort <strong>und</strong> bildet Höhlensysteme. In einer Karstquelle<br />
tritt es am Rande des Karstgebietes wieder an die<br />
Oberfläche. Dolinen (Abb. 1.29) sind typische<br />
Erscheinungen in Karstgebieten.<br />
Nicht alle kalkhaltigen Gesteine sind gleich gut löslich,<br />
hauptsächlich Quintner Kalk, Schrattenkalk <strong>und</strong><br />
Seewer Kalk sind verkarstungsfähig. Mergelige, tonige<br />
Schichten wie Amdener Mergel oder Drusberg-<br />
Schichten hingegen lösen sich weit weniger. Sie bilden<br />
deshalb oft die Basis von Höhlensystemen <strong>und</strong> wirken<br />
als Gr<strong>und</strong>wasserstauer.<br />
Ausgedehnte Karstlandschaften wie Silberen <strong>und</strong> Charetalp,<br />
Glattalp <strong>und</strong> Wägitaler Berge prägen die<br />
<strong>Schwyz</strong>er Alpen. Der <strong>Kanton</strong> <strong>Schwyz</strong> beheimatet mit<br />
dem Höllloch das grösste Höhlensystem Europas <strong>und</strong><br />
eines der grössten der Welt. Die vermessene Gesamtlänge<br />
beträgt 186 km (Stand 2002). Das benachbarte<br />
35 km lange Silberensystem ist mit dem Höllloch<br />
durch eine noch nicht begehbare eingestürzte Zone<br />
verb<strong>und</strong>en. Diese Höhlen bildeten sich hauptsächlich<br />
im Schrattenkalk, Seewer Kalk <strong>und</strong> teilweise in den<br />
Drusberg-Schichten (WILDBERGER & PREISWERK<br />
1997). Neben den beiden Systemen wurden im <strong>Kanton</strong><br />
einige H<strong>und</strong>ert grössere <strong>und</strong> kleinere Höhlen entdeckt<br />
<strong>und</strong> vermessen.<br />
Abb. 1.29 Dolinen zwischen Spirstock <strong>und</strong> Nühüttli. Im<br />
Untergr<strong>und</strong> wird Gestein weggelöst bis die Hohlräume<br />
zu gross werden <strong>und</strong> einstürzen. An der<br />
Oberfläche sind in der Folge Einsturztrichter<br />
erkennbar.<br />
27