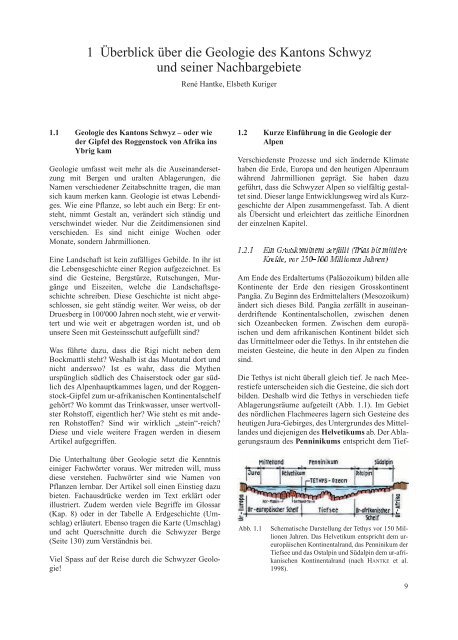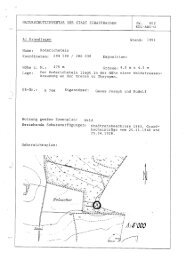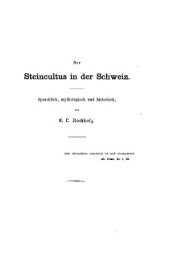Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...
Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...
Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
1 Überblick über die <strong>Geologie</strong> des <strong>Kanton</strong>s <strong>Schwyz</strong><br />
<strong>und</strong> seiner Nachbargebiete<br />
1.1 <strong>Geologie</strong> des <strong>Kanton</strong>s <strong>Schwyz</strong> – oder wie<br />
der Gipfel des Roggenstock von Afrika ins<br />
Ybrig kam<br />
<strong>Geologie</strong> umfasst weit mehr als die Auseinandersetzung<br />
mit Bergen <strong>und</strong> uralten Ablagerungen, die<br />
Namen verschiedener Zeitabschnitte tragen, die man<br />
sich kaum merken kann. <strong>Geologie</strong> ist etwas Lebendiges.<br />
Wie eine Pflanze, so lebt auch ein Berg: Er entsteht,<br />
nimmt Gestalt an, verändert sich ständig <strong>und</strong><br />
verschwindet wieder. Nur die Zeitdimensionen sind<br />
verschieden. Es sind nicht einige Wochen oder<br />
Monate, sondern Jahrmillionen.<br />
Eine Landschaft ist kein zufälliges Gebilde. In ihr ist<br />
die Lebensgeschichte einer Region aufgezeichnet. Es<br />
sind die Gesteine, Bergstürze, Rutschungen, Murgänge<br />
<strong>und</strong> Eiszeiten, welche die Landschaftsgeschichte<br />
schreiben. Diese Geschichte ist nicht abgeschlossen,<br />
sie geht ständig weiter. Wer weiss, ob der<br />
Druesberg in 100'000 Jahren noch steht, wie er verwittert<br />
<strong>und</strong> wie weit er abgetragen worden ist, <strong>und</strong> ob<br />
unsere Seen mit Gesteinsschutt aufgefüllt sind?<br />
Was führte dazu, dass die Rigi nicht neben dem<br />
Bockmattli steht? Weshalb ist das Muotatal dort <strong>und</strong><br />
nicht anderswo? Ist es wahr, dass die Mythen<br />
urspünglich südlich des Chaiserstock oder gar südlich<br />
des Alpenhauptkammes lagen, <strong>und</strong> der Roggenstock-Gipfel<br />
zum ur-afrikanischen Kontinentalschelf<br />
gehört? Wo kommt das Trinkwasser, unser wertvollster<br />
Rohstoff, eigentlich her? Wie steht es mit anderen<br />
Rohstoffen? Sind wir wirklich „stein“-reich?<br />
Diese <strong>und</strong> viele weitere Fragen werden in diesem<br />
Artikel aufgegriffen.<br />
Die Unterhaltung über <strong>Geologie</strong> setzt die Kenntnis<br />
einiger Fachwörter voraus. Wer mitreden will, muss<br />
diese verstehen. Fachwörter sind wie Namen von<br />
Pflanzen lernbar. Der Artikel soll einen Einstieg dazu<br />
bieten. Fachausdrücke werden im Text erklärt oder<br />
illustriert. Zudem werden viele Begriffe im Glossar<br />
(Kap. 8) oder in der Tabelle A Erdgeschichte (Umschlag)<br />
erläutert. Ebenso tragen die Karte (Umschlag)<br />
<strong>und</strong> acht Querschnitte durch die <strong>Schwyz</strong>er Berge<br />
(Seite 130) zum Verständnis bei.<br />
Viel Spass auf der Reise durch die <strong>Schwyz</strong>er <strong>Geologie</strong>!<br />
René Hantke, Elsbeth Kuriger<br />
1.2 Kurze Einführung in die <strong>Geologie</strong> der<br />
Alpen<br />
Verschiedenste Prozesse <strong>und</strong> sich ändernde Klimate<br />
haben die Erde, Europa <strong>und</strong> den heutigen Alpenraum<br />
während Jahrmillionen geprägt. Sie haben dazu<br />
geführt, dass die <strong>Schwyz</strong>er Alpen so vielfältig gestaltet<br />
sind. Dieser lange Entwicklungsweg wird als Kurzgeschichte<br />
der Alpen zusammengefasst. Tab. A dient<br />
als Übersicht <strong>und</strong> erleichtert das zeitliche Einordnen<br />
der einzelnen Kapitel.<br />
Am Ende des Erdaltertums (Paläozoikum) bilden alle<br />
Kontinente der Erde den riesigen Grosskontinent<br />
Pangäa. Zu Beginn des Erdmittelalters (Mesozoikum)<br />
ändert sich dieses Bild. Pangäa zerfällt in auseinanderdriftende<br />
Kontinentalschollen, zwischen denen<br />
sich Ozeanbecken formen. Zwischen dem europäischen<br />
<strong>und</strong> dem afrikanischen Kontinent bildet sich<br />
das Urmittelmeer oder die Tethys. In ihr entstehen die<br />
meisten Gesteine, die heute in den Alpen zu finden<br />
sind.<br />
Die Tethys ist nicht überall gleich tief. Je nach Meerestiefe<br />
unterscheiden sich die Gesteine, die sich dort<br />
bilden. Deshalb wird die Tethys in verschieden tiefe<br />
Ablagerungsräume aufgeteilt (Abb. 1.1). Im Gebiet<br />
des nördlichen Flachmeeres lagern sich Gesteine des<br />
heutigen Jura-Gebirges, des Untergr<strong>und</strong>es des Mittellandes<br />
<strong>und</strong> diejenigen des Helvetikums ab. Der Ablagerungsraum<br />
des Penninikums entspricht dem Tief-<br />
Abb. 1.1 Schematische Darstellung der Tethys vor 150 Millionen<br />
Jahren. Das Helvetikum entspricht dem ureuropäischen<br />
Kontinentalrand, das Penninikum der<br />
Tiefsee <strong>und</strong> das Ostalpin <strong>und</strong> Südalpin dem ur-afrikanischen<br />
Kontinentalrand (nach HANTKE et al.<br />
1998).<br />
9