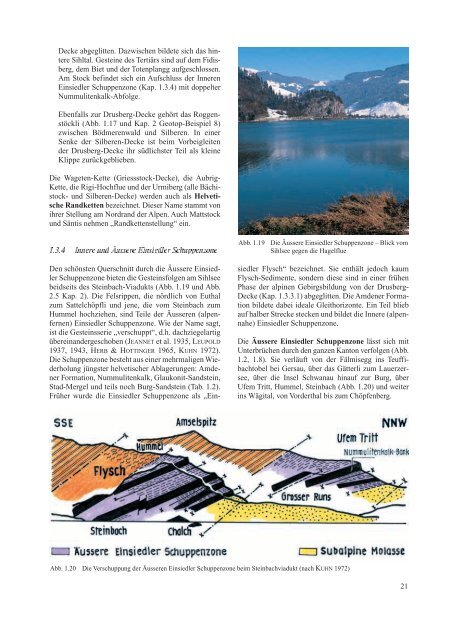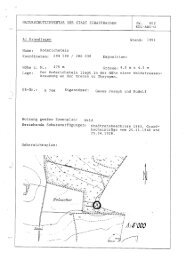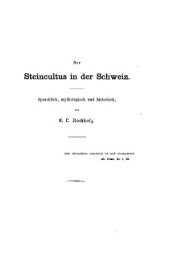Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...
Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...
Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Decke abgeglitten. Dazwischen bildete sich das hintere<br />
Sihltal. Gesteine des Tertiärs sind auf dem Fidisberg,<br />
dem Biet <strong>und</strong> der Totenplangg aufgeschlossen.<br />
Am Stock befindet sich ein Aufschluss der Inneren<br />
Einsiedler Schuppenzone (Kap. 1.3.4) mit doppelter<br />
Nummulitenkalk-Abfolge.<br />
Ebenfalls zur Drusberg-Decke gehört das Roggenstöckli<br />
(Abb. 1.17 <strong>und</strong> Kap. 2 Geotop-Beispiel 8)<br />
zwischen Bödmerenwald <strong>und</strong> Silberen. In einer<br />
Senke der Silberen-Decke ist beim Vorbeigleiten<br />
der Drusberg-Decke ihr südlichster Teil als kleine<br />
Klippe zurückgeblieben.<br />
Die Wageten-Kette (Griessstock-Decke), die Aubrig-<br />
Kette, die Rigi-Hochflue <strong>und</strong> der Urmiberg (alle Bächistock-<br />
<strong>und</strong> Silberen-Decke) werden auch als Helvetische<br />
Randketten bezeichnet. Dieser Name stammt von<br />
ihrer Stellung am Nordrand der Alpen. Auch Mattstock<br />
<strong>und</strong> Säntis nehmen „Randkettenstellung“ ein.<br />
Den schönsten Querschnitt durch die Äussere Einsiedler<br />
Schuppenzone bieten die Gesteinsfolgen am Sihlsee<br />
beidseits des Steinbach-Viadukts (Abb. 1.19 <strong>und</strong> Abb.<br />
2.5 Kap. 2). Die Felsrippen, die nördlich von Euthal<br />
zum Sattelchöpfli <strong>und</strong> jene, die vom Steinbach zum<br />
Hummel hochziehen, sind Teile der Äusseren (alpenfernen)<br />
Einsiedler Schuppenzone. Wie der Name sagt,<br />
ist die Gesteinsserie „verschuppt“, d.h. dachziegelartig<br />
übereinandergeschoben (JEANNET et al. 1935, LEUPOLD<br />
1937, 1943, HERB & HOTTINGER 1965, KUHN 1972).<br />
Die Schuppenzone besteht aus einer mehrmaligen Wiederholung<br />
jüngster helvetischer Ablagerungen: Amdener<br />
Formation, Nummulitenkalk, Glaukonit-Sandstein,<br />
Stad-Mergel <strong>und</strong> teils noch Burg-Sandstein (Tab. 1.2).<br />
Früher wurde die Einsiedler Schuppenzone als „Ein-<br />
Abb. 1.19 Die Äussere Einsiedler Schuppenzone – Blick vom<br />
Sihlsee gegen die Hagelflue<br />
siedler Flysch“ bezeichnet. Sie enthält jedoch kaum<br />
Flysch-Sedimente, sondern diese sind in einer frühen<br />
Phase der alpinen Gebirgsbildung von der Drusberg-<br />
Decke (Kap. 1.3.3.1) abgeglitten. Die Amdener Formation<br />
bildete dabei ideale Gleithorizonte. Ein Teil blieb<br />
auf halber Strecke stecken <strong>und</strong> bildet die Innere (alpennahe)<br />
Einsiedler Schuppenzone.<br />
Die Äussere Einsiedler Schuppenzone lässt sich mit<br />
Unterbrüchen durch den ganzen <strong>Kanton</strong> verfolgen (Abb.<br />
1.2, 1.8). Sie verläuft von der Fälmisegg ins Teuffibachtobel<br />
bei Gersau, über das Gätterli zum Lauerzersee,<br />
über die Insel Schwanau hinauf zur Burg, über<br />
Ufem Tritt, Hummel, Steinbach (Abb. 1.20) <strong>und</strong> weiter<br />
ins Wägital, von Vorderthal bis zum Chöpfenberg.<br />
Abb. 1.20 Die Verschuppung der Äusseren Einsiedler Schuppenzone beim Steinbachviadukt (nach KUHN 1972)<br />
21