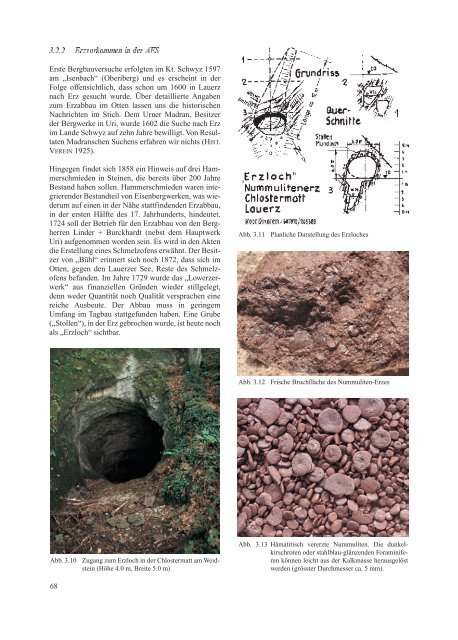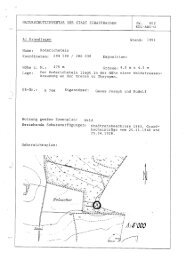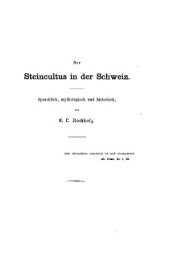Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...
Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...
Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Erste Bergbauversuche erfolgten im Kt. <strong>Schwyz</strong> 1597<br />
am „Isenbach“ (Oberiberg) <strong>und</strong> es erscheint in der<br />
Folge offensichtlich, dass schon um 1600 in Lauerz<br />
nach Erz gesucht wurde. Über detaillierte Angaben<br />
zum Erzabbau im Otten lassen uns die historischen<br />
Nachrichten im Stich. Dem Urner Madran, Besitzer<br />
der Bergwerke in Uri, wurde 1602 die Suche nach Erz<br />
im Lande <strong>Schwyz</strong> auf zehn Jahre bewilligt. Von Resultaten<br />
Madranschen Suchens erfahren wir nichts (HIST.<br />
VEREIN 1925).<br />
Hingegen findet sich 1858 ein Hinweis auf drei Hammerschmieden<br />
in Steinen, die bereits über 200 Jahre<br />
Bestand haben sollen. Hammerschmieden waren integrierender<br />
Bestandteil von Eisenbergwerken, was wiederum<br />
auf einen in der Nähe stattfindenden Erzabbau,<br />
in der ersten Hälfte des 17. Jahrh<strong>und</strong>erts, hindeutet.<br />
1724 soll der Betrieb für den Erzabbau von den Bergherren<br />
Linder + Burckhardt (nebst dem Hauptwerk<br />
Uri) aufgenommen worden sein. Es wird in den Akten<br />
die Erstellung eines Schmelzofens erwähnt. Der Besitzer<br />
von „Bühl“ erinnert sich noch 1872, dass sich im<br />
Otten, gegen den Lauerzer See, Reste des Schmelzofens<br />
befanden. Im Jahre 1729 wurde das „Lowerzerwerk“<br />
aus finanziellen Gründen wieder stillgelegt,<br />
denn weder Quantität noch Qualität versprachen eine<br />
reiche Ausbeute. Der Abbau muss in geringem<br />
Umfang im Tagbau stattgef<strong>und</strong>en haben. Eine Grube<br />
(„Stollen“), in der Erz gebrochen wurde, ist heute noch<br />
als „Erzloch“ sichtbar.<br />
Abb. 3.10 Zugang zum Erzloch in der Chlostermatt am Weidstein<br />
(Höhe 4.0 m, Breite 5.0 m)<br />
68<br />
Abb. 3.11 Planliche Darstellung des Erzloches<br />
Abb. 3.12 Frische Bruchfläche des Nummuliten-Erzes<br />
Abb. 3.13 Hämatitisch vererzte Nummuliten. Die dunkelkirschroten<br />
oder stahlblau-glänzenden Foraminiferen<br />
können leicht aus der Kalkmasse herausgelöst<br />
werden (grösster Durchmesser ca. 5 mm).