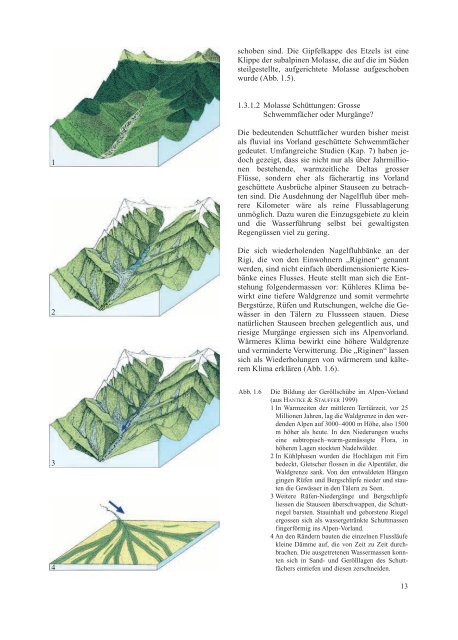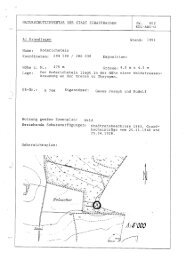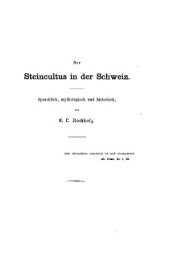Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...
Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...
Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
schoben sind. Die Gipfelkappe des Etzels ist eine<br />
Klippe der subalpinen Molasse, die auf die im Süden<br />
steilgestellte, aufgerichtete Molasse aufgeschoben<br />
wurde (Abb. 1.5).<br />
1.3.1.2 Molasse Schüttungen: Grosse<br />
Schwemmfächer oder Murgänge?<br />
Die bedeutenden Schuttfächer wurden bisher meist<br />
als fluvial ins Vorland geschüttete Schwemmfächer<br />
gedeutet. Umfangreiche Studien (Kap. 7) haben jedoch<br />
gezeigt, dass sie nicht nur als über Jahrmillionen<br />
bestehende, warmzeitliche Deltas grosser<br />
Flüsse, sondern eher als fächerartig ins Vorland<br />
geschüttete Ausbrüche alpiner Stauseen zu betrachten<br />
sind. Die Ausdehnung der Nagelfluh über mehrere<br />
Kilometer wäre als reine Flussablagerung<br />
unmöglich. Dazu waren die Einzugsgebiete zu klein<br />
<strong>und</strong> die Wasserführung selbst bei gewaltigsten<br />
Regengüssen viel zu gering.<br />
Die sich wiederholenden Nagelfluhbänke an der<br />
Rigi, die von den Einwohnern „Riginen“ genannt<br />
werden, sind nicht einfach überdimensionierte Kiesbänke<br />
eines Flusses. Heute stellt man sich die Entstehung<br />
folgendermassen vor: Kühleres Klima bewirkt<br />
eine tiefere Waldgrenze <strong>und</strong> somit vermehrte<br />
Bergstürze, Rüfen <strong>und</strong> Rutschungen, welche die Gewässer<br />
in den Tälern zu Flussseen stauen. Diese<br />
natürlichen Stauseen brechen gelegentlich aus, <strong>und</strong><br />
riesige Murgänge ergiessen sich ins Alpenvorland.<br />
Wärmeres Klima bewirkt eine höhere Waldgrenze<br />
<strong>und</strong> verminderte Verwitterung. Die „Riginen“ lassen<br />
sich als Wiederholungen von wärmerem <strong>und</strong> kälterem<br />
Klima erklären (Abb. 1.6).<br />
Abb. 1.6 Die Bildung der Geröllschübe im Alpen-Vorland<br />
(aus HANTKE &STAUFFER 1999)<br />
1 In Warmzeiten der mittleren Tertiärzeit, vor 25<br />
Millionen Jahren, lag die Waldgrenze in den werdenden<br />
Alpen auf 3000–4000 m Höhe, also 1500<br />
m höher als heute. In den Niederungen wuchs<br />
eine subtropisch–warm-gemässigte Flora, in<br />
höheren Lagen stockten Nadelwälder.<br />
2 In Kühlphasen wurden die Hochlagen mit Firn<br />
bedeckt, Gletscher flossen in die Alpentäler, die<br />
Waldgrenze sank. Von den entwaldeten Hängen<br />
gingen Rüfen <strong>und</strong> Bergschlipfe nieder <strong>und</strong> stauten<br />
die Gewässer in den Tälern zu Seen.<br />
3 Weitere Rüfen-Niedergänge <strong>und</strong> Bergschlipfe<br />
liessen die Stauseen überschwappen, die Schuttriegel<br />
barsten. Stauinhalt <strong>und</strong> geborstene Riegel<br />
ergossen sich als wassergetränkte Schuttmassen<br />
fingerförmig ins Alpen-Vorland.<br />
4 An den Rändern bauten die einzelnen Flussläufe<br />
kleine Dämme auf, die von Zeit zu Zeit durchbrachen.<br />
Die ausgetretenen Wassermassen konnten<br />
sich in Sand- <strong>und</strong> Gerölllagen des Schuttfächers<br />
eintiefen <strong>und</strong> diesen zerschneiden.<br />
13