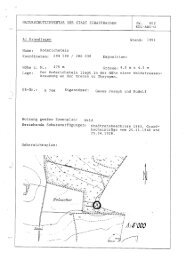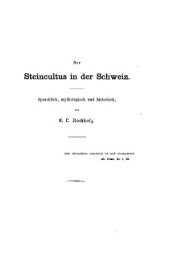Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...
Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...
Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Schutt füllte die Mulde. In der Rinnenfüllung sind<br />
palynologisch zwei Warmzeiten nachgewiesen (SID-<br />
LER 1988). Darunter folgen noch mindestens 170 m<br />
moränenartige Sedimente, die in ihrer Position – quer<br />
zur Fliessrichtung der Gletscher – eine Reihe weiterer<br />
Kalt/Warmzeit-Zyklen beinhalten können; zuunterst<br />
sind Sande erbohrt worden (WYSSLING & FELBER<br />
1995). Die untere Moränen-Abfolge möchte WYSS-<br />
LING (2002) als Gr<strong>und</strong>moräne einer einzigen Kaltzeit,<br />
der „Grössten Eiszeit“, zuweisen. Eine derart mächtige<br />
„Gr<strong>und</strong>“moräne einer einzigen Kaltzeit wäre<br />
absolut einmalig. Die Verfrachtung zäher, kompakter<br />
„Gr<strong>und</strong>“moräne am Gletscherboden, wo die Schubkraft<br />
des Gletschers scharf abfällt, ist auszuschliessen.<br />
Dagegen erfolgte der Transport problemlos als zu<br />
Obermoräne vereinigten Mittelmoränen, bei der das<br />
Eis als Förderband gewirkt hat (WAGNER 2001c). Wohl<br />
tritt Gr<strong>und</strong>moräne meist am Gletschergr<strong>und</strong> auf; doch<br />
sind Wysslings Dimensionen um zwei Grössenordnungen<br />
zu gross.<br />
Der Nachweis der Menzinger Rinne <strong>und</strong> ihre Füllung<br />
haben nicht nur Konsequenzen für die Deutung der<br />
Geschichte zwischen Zürichsee <strong>und</strong> Zuger See. Nach<br />
bisheriger Auffassung wären die Täler des Mittellandes<br />
in Warmzeiten des Eiszeitalters bei bis über 70 %<br />
Waldbedeckung im Alpen-Vorland <strong>und</strong> in den N-<br />
Alpen sukzessive eingetieft worden. In den Kaltzeiten<br />
wären vor den anrückenden Gletschern jeweils auf<br />
immer tieferen Niveaus gewaltige Schotterfluren<br />
geschüttet worden: Höherer, Mittlerer <strong>und</strong> Tieferer<br />
Deckenschotter. Am bayerischen Eisrand werden zuoberst<br />
noch ältere Deckschotter unterschieden.<br />
In den Schweizer Deckenschottern lassen sich geröllanalytisch<br />
verschiedene Schotterstränge auseinanderhalten,<br />
so dass sich diese gliedern lassen (GRAF 1993,<br />
1995, in MATOUSEK et al. 2000K, BITTERLI et al. 2000K,<br />
BOLLIGER et al. 1996, HANTKE & WAGNER 2003a,b,<br />
HANTKE et al. 2003) <strong>und</strong> teils pliozänes Alter belegen.<br />
Unterhalb der Deckenschotter werden für eine differenziertere<br />
Geschichte des mittleren <strong>und</strong> jüngeren<br />
Pleistozäns – je nach Schule – weitere, vom jeweiligen<br />
Eisrand aus geschüttete Schotterfluren unterschieden:<br />
mehrere Hoch-, Mittel- <strong>und</strong> Niederterrassenschotter.<br />
Für all diese höheren schweizerischen Schotterfluren<br />
bietet sich eine weit realistischere Deutung an: Sie<br />
wurden lokal vom Rand in bereits in Tälern fliessenden<br />
Gletschern auf eisfreie Hochflächen geschüttet.<br />
Dabei kommt den Mittelmoränen für die Lieferung<br />
des Schuttgutes entscheidende Bedeutung zu (HANTKE<br />
1991 S. 208; WAGNER 1997 S. 134, WAGNER 2001c):<br />
Es sind auf Molasse- oder Tafeljura-Riedel auf Gr<strong>und</strong><br />
gelaufene, durch Schmelzwasser <strong>und</strong> Regengüsse ver-<br />
112<br />
frachtete, „moränennahe“ Schotterfluren (HANTKE &<br />
WAGNER 2003a,b).<br />
Wie steht es mit dem in den Erdwissenschaften immer<br />
wieder diskutierten Abtrag von Deckenteilen <strong>und</strong> von<br />
ganzen Decken? Im Muotatal, auf Silberen, Charetalp<br />
<strong>und</strong> Glattalp, lässt sich der Abtrag durch Lösung bei<br />
auf nacktem Kalkhochflächen aufliegenden Findlingen<br />
ermitteln. Unter ihnen hat sich ein maximal 10–12<br />
cm hoher, an Gletschertische erinnernder Kalkschemel<br />
gebildet. Die Findlinge liegen auf einem Kranz auf<br />
dem Silberen-Plateau; für einen letztspätwürmzeitlichen<br />
Moränenwall hat die Substanz nicht ausgereicht.<br />
Doch haben die Blöcke seit dem Eisvorstoss vor<br />
11'000 Jahren die Karsthochfläche vor Lösungsabtrag<br />
geschützt (Abb. 7.2). Aus der Höhe der Kalkschemel<br />
resultiert ein Abtrag der umliegenden Karstfläche von<br />
1 cm in 1000 Jahren. Ähnliche Schemel finden sich<br />
auf Rautialp (Kt. Glarus), <strong>und</strong> BRÜCKNER (1956b) hat<br />
solche – noch ohne chemischen Abtrag – vom Hoch<br />
Fulen-Gebiet (Kt. Uri) beschrieben.<br />
Abb. 7.2 Erratiker auf Kalkschemel des letzten spätwürmzeitlichen<br />
Eisvorstosses auf Oberist Twärenen, Silberen<br />
(Kt. <strong>Schwyz</strong>). Unter dem Erratiker blieb die<br />
Oberfläche vor der Karbonatlösung durch Regen<strong>und</strong><br />
Schneeschmelzwasser bewahrt: Es entstand<br />
ein Kalkschemel. Bei Blöcken, die sich im letzten<br />
spätwürmzeitlichen Gletschervorstoss abgesetzt<br />
haben, erlaubt die Schemelhöhe von 10–12 cm eine<br />
Lösungsrate von 1 cm/1000 Jahre zu ermitteln.<br />
Für die Zeit seit der Platznahme der helvetischen<br />
Decken vor fünf Mio. Jahren ergäbe sich zunächst ein<br />
Lösungsabtrag von maximal 50 m. Auf den flachen<br />
Hochflächen war dieser jedoch unter dem kaltzeitlichen<br />
Eisschild geringer Vorstoss- <strong>und</strong> Abschmelzphasen<br />
haben später eingesetzt <strong>und</strong> früher aufgehört.<br />
An vertikalen Flächen – zwischen Schrattenkalk <strong>und</strong><br />
eingepresstem Kieselkalk der aufliegenden Toralp-<br />
Abfolge – konnten gar nur wenige cm bis dm beobachtet<br />
werden. Der mechanische Abtrag ist auf den<br />
Hochflächen minimal; er beschränkt sich auf lokales