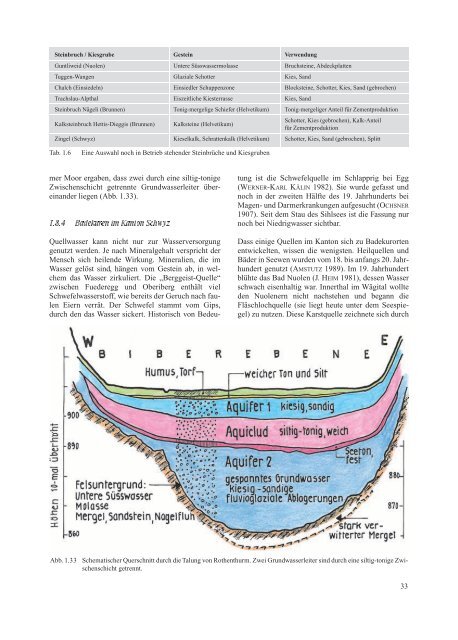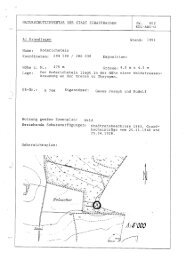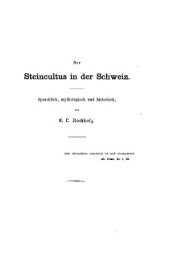Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...
Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...
Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Steinbruch / Kiesgrube Gestein Verwendung<br />
Guntliweid (Nuolen) Untere Süsswassermolasse Bruchsteine, Abdeckplatten<br />
Tuggen-Wangen Glaziale Schotter Kies, Sand<br />
Chalch (Einsiedeln) Einsiedler Schuppenzone Blocksteine, Schotter, Kies, Sand (gebrochen)<br />
Trachslau-Alpthal Eiszeitliche Kiesterrasse Kies, Sand<br />
Steinbruch Nägeli (Brunnen) Tonig-mergelige Schiefer (Helvetikum) Tonig-mergeliger Anteil für Zementproduktion<br />
Kalksteinbruch Hettis-Dieggis (Brunnen) Kalksteine (Helvetikum)<br />
mer Moor ergaben, dass zwei durch eine siltig-tonige<br />
Zwischenschicht getrennte Gr<strong>und</strong>wasserleiter übereinander<br />
liegen (Abb. 1.33).<br />
Quellwasser kann nicht nur zur Wasserversorgung<br />
genutzt werden. Je nach Mineralgehalt verspricht der<br />
Mensch sich heilende Wirkung. Mineralien, die im<br />
Wasser gelöst sind, hängen vom Gestein ab, in welchem<br />
das Wasser zirkuliert. Die „Berggeist-Quelle“<br />
zwischen Fuederegg <strong>und</strong> Oberiberg enthält viel<br />
Schwefelwasserstoff, wie bereits der Geruch nach faulen<br />
Eiern verrät. Der Schwefel stammt vom Gips,<br />
durch den das Wasser sickert. Historisch von Bedeu-<br />
Schotter, Kies (gebrochen), Kalk-Anteil<br />
für Zementproduktion<br />
Zingel (<strong>Schwyz</strong>) Kieselkalk, Schrattenkalk (Helvetikum) Schotter, Kies, Sand (gebrochen), Splitt<br />
Tab. 1.6 Eine Auswahl noch in Betrieb stehender Steinbrüche <strong>und</strong> Kiesgruben<br />
tung ist die Schwefelquelle im Schlapprig bei Egg<br />
(WERNER-KARL KÄLIN 1982). Sie wurde gefasst <strong>und</strong><br />
noch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts bei<br />
Magen- <strong>und</strong> Darmerkrankungen aufgesucht (OCHSNER<br />
1907). Seit dem Stau des Sihlsees ist die Fassung nur<br />
noch bei Niedrigwasser sichtbar.<br />
Dass einige Quellen im <strong>Kanton</strong> sich zu Badekurorten<br />
entwickelten, wissen die wenigsten. Heilquellen <strong>und</strong><br />
Bäder in Seewen wurden vom 18. bis anfangs 20. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
genutzt (AMSTUTZ 1989). Im 19. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
blühte das Bad Nuolen (J. HEIM 1981), dessen Wasser<br />
schwach eisenhaltig war. Innerthal im Wägital wollte<br />
den Nuolenern nicht nachstehen <strong>und</strong> begann die<br />
Fläschlochquelle (sie liegt heute unter dem Seespiegel)<br />
zu nutzen. Diese Karstquelle zeichnete sich durch<br />
Abb. 1.33 Schematischer Querschnitt durch die Talung von Rothenthurm. Zwei Gr<strong>und</strong>wasserleiter sind durch eine siltig-tonige Zwischenschicht<br />
getrennt.<br />
33