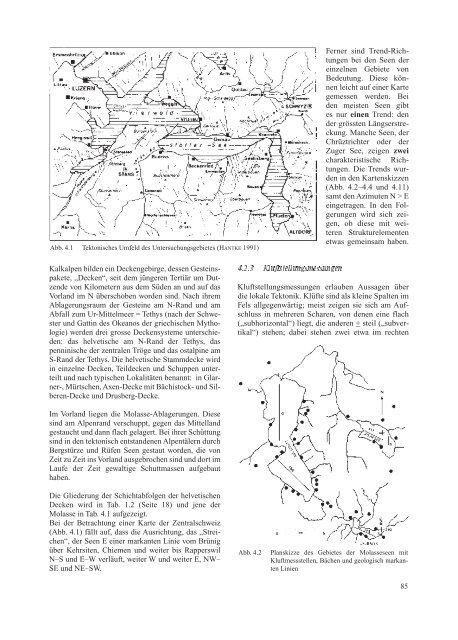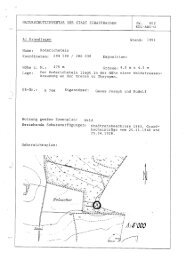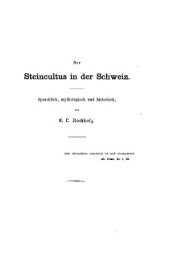Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...
Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...
Naturforschende Gesellschaft Kanton Schwyz - Geologie und ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Abb. 4.1 Tektonisches Umfeld des Untersuchungsgebietes (HANTKE 1991)<br />
Kalkalpen bilden ein Deckengebirge, dessen Gesteinspakete,<br />
„Decken“, seit dem jüngeren Tertiär um Dutzende<br />
von Kilometern aus dem Süden an <strong>und</strong> auf das<br />
Vorland im N überschoben worden sind. Nach ihrem<br />
Ablagerungsraum der Gesteine am N-Rand <strong>und</strong> am<br />
Abfall zum Ur-Mittelmeer = Tethys (nach der Schwester<br />
<strong>und</strong> Gattin des Okeanos der griechischen Mythologie)<br />
werden drei grosse Deckensysteme unterschieden:<br />
das helvetische am N-Rand der Tethys, das<br />
penninische der zentralen Tröge <strong>und</strong> das ostalpine am<br />
S-Rand der Tethys. Die helvetische Stammdecke wird<br />
in einzelne Decken, Teildecken <strong>und</strong> Schuppen unterteilt<br />
<strong>und</strong> nach typischen Lokalitäten benannt: in Glarner-,<br />
Mürtschen, Axen-Decke mit Bächistock- <strong>und</strong> Silberen-Decke<br />
<strong>und</strong> Drusberg-Decke.<br />
Im Vorland liegen die Molasse-Ablagerungen. Diese<br />
sind am Alpenrand verschuppt, gegen das Mittelland<br />
gestaucht <strong>und</strong> dann flach gelagert. Bei ihrer Schüttung<br />
sind in den tektonisch entstandenen Alpentälern durch<br />
Bergstürze <strong>und</strong> Rüfen Seen gestaut worden, die von<br />
Zeit zu Zeit ins Vorland ausgebrochen sind <strong>und</strong> dort im<br />
Laufe der Zeit gewaltige Schuttmassen aufgebaut<br />
haben.<br />
Die Gliederung der Schichtabfolgen der helvetischen<br />
Decken wird in Tab. 1.2 (Seite 18) <strong>und</strong> jene der<br />
Molasse in Tab. 4.1 aufgezeigt.<br />
Bei der Betrachtung einer Karte der Zentralschweiz<br />
(Abb. 4.1) fällt auf, dass die Ausrichtung, das „Streichen“,<br />
der Seen E einer markanten Linie vom Brünig<br />
über Kehrsiten, Chiemen <strong>und</strong> weiter bis Rapperswil<br />
N–S <strong>und</strong> E–W verläuft, weiter W <strong>und</strong> weiter E, NW–<br />
SE <strong>und</strong> NE–SW.<br />
Ferner sind Trend-Richtungen<br />
bei den Seen der<br />
einzelnen Gebiete von<br />
Bedeutung. Diese können<br />
leicht auf einer Karte<br />
gemessen werden. Bei<br />
den meisten Seen gibt<br />
es nur einen Trend: den<br />
der grössten Längserstreckung.<br />
Manche Seen, der<br />
Chrüztrichter oder der<br />
Zuger See, zeigen zwei<br />
charakteristische Richtungen.<br />
Die Trends wurden<br />
in den Kartenskizzen<br />
(Abb. 4.2–4.4 <strong>und</strong> 4.11)<br />
samt den Azimuten N > E<br />
eingetragen. In den Folgerungen<br />
wird sich zeigen,<br />
ob diese mit weiteren<br />
Strukturelementen<br />
etwas gemeinsam haben.<br />
Kluftstellungsmessungen erlauben Aussagen über<br />
die lokale Tektonik. Klüfte sind als kleine Spalten im<br />
Fels allgegenwärtig; meist zeigen sie sich am Aufschluss<br />
in mehreren Scharen, von denen eine flach<br />
(„subhorizontal“) liegt, die anderen + steil („subvertikal“)<br />
stehen; dabei stehen zwei etwa im rechten<br />
Abb. 4.2 Planskizze des Gebietes der Molasseseen mit<br />
Kluftmessstellen, Bächen <strong>und</strong> geologisch markanten<br />
Linien<br />
85