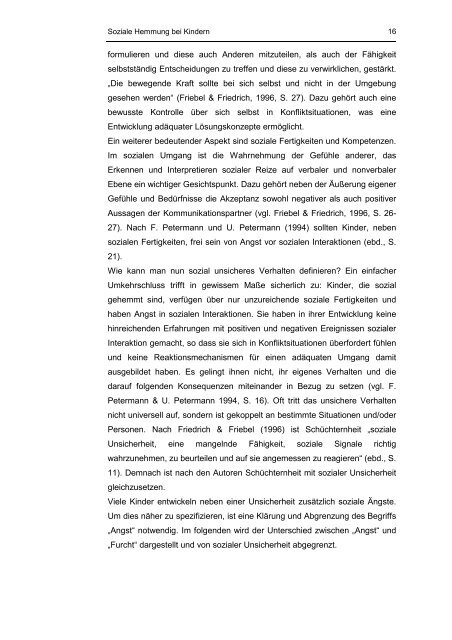Soziale Hemmung und Sprechangst bei Kindern unter dem Aspekt ...
Soziale Hemmung und Sprechangst bei Kindern unter dem Aspekt ...
Soziale Hemmung und Sprechangst bei Kindern unter dem Aspekt ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Soziale</strong> <strong>Hemmung</strong> <strong>bei</strong> <strong>Kindern</strong><br />
formulieren <strong>und</strong> diese auch Anderen mitzuteilen, als auch der Fähigkeit<br />
selbstständig Entscheidungen zu treffen <strong>und</strong> diese zu verwirklichen, gestärkt.<br />
„Die bewegende Kraft sollte <strong>bei</strong> sich selbst <strong>und</strong> nicht in der Umgebung<br />
gesehen werden“ (Friebel & Friedrich, 1996, S. 27). Dazu gehört auch eine<br />
bewusste Kontrolle über sich selbst in Konfliktsituationen, was eine<br />
Entwicklung adäquater Lösungskonzepte ermöglicht.<br />
Ein weiterer bedeutender <strong>Aspekt</strong> sind soziale Fertigkeiten <strong>und</strong> Kompetenzen.<br />
Im sozialen Umgang ist die Wahrnehmung der Gefühle anderer, das<br />
Erkennen <strong>und</strong> Interpretieren sozialer Reize auf verbaler <strong>und</strong> nonverbaler<br />
Ebene ein wichtiger Gesichtspunkt. Dazu gehört neben der Äußerung eigener<br />
Gefühle <strong>und</strong> Bedürfnisse die Akzeptanz sowohl negativer als auch positiver<br />
Aussagen der Kommunikationspartner (vgl. Friebel & Friedrich, 1996, S. 26-<br />
27). Nach F. Petermann <strong>und</strong> U. Petermann (1994) sollten Kinder, neben<br />
sozialen Fertigkeiten, frei sein von Angst vor sozialen Interaktionen (ebd., S.<br />
21).<br />
Wie kann man nun sozial unsicheres Verhalten definieren? Ein einfacher<br />
Umkehrschluss trifft in gewissem Maße sicherlich zu: Kinder, die sozial<br />
gehemmt sind, verfügen über nur unzureichende soziale Fertigkeiten <strong>und</strong><br />
haben Angst in sozialen Interaktionen. Sie haben in ihrer Entwicklung keine<br />
hinreichenden Erfahrungen mit positiven <strong>und</strong> negativen Ereignissen sozialer<br />
Interaktion gemacht, so dass sie sich in Konfliktsituationen überfordert fühlen<br />
<strong>und</strong> keine Reaktionsmechanismen für einen adäquaten Umgang damit<br />
ausgebildet haben. Es gelingt ihnen nicht, ihr eigenes Verhalten <strong>und</strong> die<br />
darauf folgenden Konsequenzen miteinander in Bezug zu setzen (vgl. F.<br />
Petermann & U. Petermann 1994, S. 16). Oft tritt das unsichere Verhalten<br />
nicht universell auf, sondern ist gekoppelt an bestimmte Situationen <strong>und</strong>/oder<br />
Personen. Nach Friedrich & Friebel (1996) ist Schüchternheit „soziale<br />
Unsicherheit, eine mangelnde Fähigkeit, soziale Signale richtig<br />
wahrzunehmen, zu beurteilen <strong>und</strong> auf sie angemessen zu reagieren“ (ebd., S.<br />
11). Demnach ist nach den Autoren Schüchternheit mit sozialer Unsicherheit<br />
gleichzusetzen.<br />
Viele Kinder entwickeln neben einer Unsicherheit zusätzlich soziale Ängste.<br />
Um dies näher zu spezifizieren, ist eine Klärung <strong>und</strong> Abgrenzung des Begriffs<br />
„Angst“ notwendig. Im folgenden wird der Unterschied zwischen „Angst“ <strong>und</strong><br />
„Furcht“ dargestellt <strong>und</strong> von sozialer Unsicherheit abgegrenzt.<br />
16