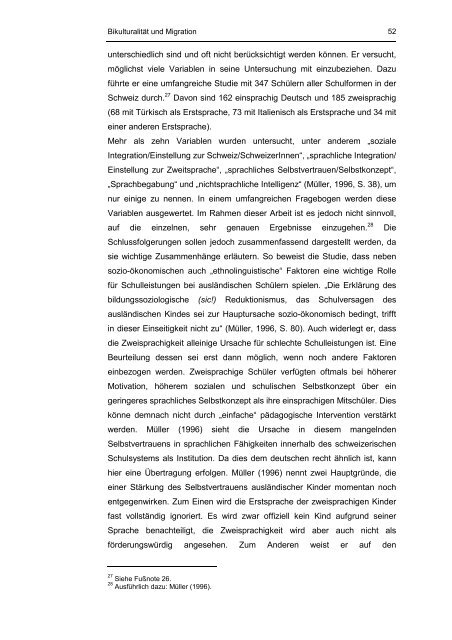Soziale Hemmung und Sprechangst bei Kindern unter dem Aspekt ...
Soziale Hemmung und Sprechangst bei Kindern unter dem Aspekt ...
Soziale Hemmung und Sprechangst bei Kindern unter dem Aspekt ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Bikulturalität <strong>und</strong> Migration<br />
<strong>unter</strong>schiedlich sind <strong>und</strong> oft nicht berücksichtigt werden können. Er versucht,<br />
möglichst viele Variablen in seine Untersuchung mit einzubeziehen. Dazu<br />
führte er eine umfangreiche Studie mit 347 Schülern aller Schulformen in der<br />
Schweiz durch. 27 Davon sind 162 einsprachig Deutsch <strong>und</strong> 185 zweisprachig<br />
(68 mit Türkisch als Erstsprache, 73 mit Italienisch als Erstsprache <strong>und</strong> 34 mit<br />
einer anderen Erstsprache).<br />
Mehr als zehn Variablen wurden <strong>unter</strong>sucht, <strong>unter</strong> anderem „soziale<br />
Integration/Einstellung zur Schweiz/SchweizerInnen“, „sprachliche Integration/<br />
Einstellung zur Zweitsprache“, „sprachliches Selbstvertrauen/Selbstkonzept“,<br />
„Sprachbegabung“ <strong>und</strong> „nichtsprachliche Intelligenz“ (Müller, 1996, S. 38), um<br />
nur einige zu nennen. In einem umfangreichen Fragebogen werden diese<br />
Variablen ausgewertet. Im Rahmen dieser Ar<strong>bei</strong>t ist es jedoch nicht sinnvoll,<br />
auf die einzelnen, sehr genauen Ergebnisse einzugehen. 28 Die<br />
Schlussfolgerungen sollen jedoch zusammenfassend dargestellt werden, da<br />
sie wichtige Zusammenhänge erläutern. So beweist die Studie, dass neben<br />
sozio-ökonomischen auch „ethnolinguistische“ Faktoren eine wichtige Rolle<br />
für Schulleistungen <strong>bei</strong> ausländischen Schülern spielen. „Die Erklärung des<br />
bildungssoziologische (sic!) Reduktionismus, das Schulversagen des<br />
ausländischen Kindes sei zur Hauptursache sozio-ökonomisch bedingt, trifft<br />
in dieser Einseitigkeit nicht zu“ (Müller, 1996, S. 80). Auch widerlegt er, dass<br />
die Zweisprachigkeit alleinige Ursache für schlechte Schulleistungen ist. Eine<br />
Beurteilung dessen sei erst dann möglich, wenn noch andere Faktoren<br />
einbezogen werden. Zweisprachige Schüler verfügten oftmals <strong>bei</strong> höherer<br />
Motivation, höherem sozialen <strong>und</strong> schulischen Selbstkonzept über ein<br />
geringeres sprachliches Selbstkonzept als ihre einsprachigen Mitschüler. Dies<br />
könne <strong>dem</strong>nach nicht durch „einfache“ pädagogische Intervention verstärkt<br />
werden. Müller (1996) sieht die Ursache in diesem mangelnden<br />
Selbstvertrauens in sprachlichen Fähigkeiten innerhalb des schweizerischen<br />
Schulsystems als Institution. Da dies <strong>dem</strong> deutschen recht ähnlich ist, kann<br />
hier eine Übertragung erfolgen. Müller (1996) nennt zwei Hauptgründe, die<br />
einer Stärkung des Selbstvertrauens ausländischer Kinder momentan noch<br />
entgegenwirken. Zum Einen wird die Erstsprache der zweisprachigen Kinder<br />
fast vollständig ignoriert. Es wird zwar offiziell kein Kind aufgr<strong>und</strong> seiner<br />
Sprache benachteiligt, die Zweisprachigkeit wird aber auch nicht als<br />
förderungswürdig angesehen. Zum Anderen weist er auf den<br />
27 Siehe Fußnote 26.<br />
28 Ausführlich dazu: Müller (1996).<br />
52