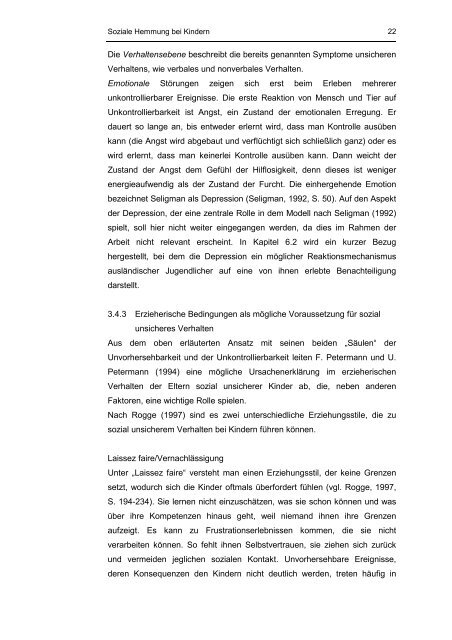Soziale Hemmung und Sprechangst bei Kindern unter dem Aspekt ...
Soziale Hemmung und Sprechangst bei Kindern unter dem Aspekt ...
Soziale Hemmung und Sprechangst bei Kindern unter dem Aspekt ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Soziale</strong> <strong>Hemmung</strong> <strong>bei</strong> <strong>Kindern</strong><br />
Die Verhaltensebene beschreibt die bereits genannten Symptome unsicheren<br />
Verhaltens, wie verbales <strong>und</strong> nonverbales Verhalten.<br />
Emotionale Störungen zeigen sich erst <strong>bei</strong>m Erleben mehrerer<br />
unkontrollierbarer Ereignisse. Die erste Reaktion von Mensch <strong>und</strong> Tier auf<br />
Unkontrollierbarkeit ist Angst, ein Zustand der emotionalen Erregung. Er<br />
dauert so lange an, bis entweder erlernt wird, dass man Kontrolle ausüben<br />
kann (die Angst wird abgebaut <strong>und</strong> verflüchtigt sich schließlich ganz) oder es<br />
wird erlernt, dass man keinerlei Kontrolle ausüben kann. Dann weicht der<br />
Zustand der Angst <strong>dem</strong> Gefühl der Hilflosigkeit, denn dieses ist weniger<br />
energieaufwendig als der Zustand der Furcht. Die einhergehende Emotion<br />
bezeichnet Seligman als Depression (Seligman, 1992, S. 50). Auf den <strong>Aspekt</strong><br />
der Depression, der eine zentrale Rolle in <strong>dem</strong> Modell nach Seligman (1992)<br />
spielt, soll hier nicht weiter eingegangen werden, da dies im Rahmen der<br />
Ar<strong>bei</strong>t nicht relevant erscheint. In Kapitel 6.2 wird ein kurzer Bezug<br />
hergestellt, <strong>bei</strong> <strong>dem</strong> die Depression ein möglicher Reaktionsmechanismus<br />
ausländischer Jugendlicher auf eine von ihnen erlebte Benachteiligung<br />
darstellt.<br />
3.4.3 Erzieherische Bedingungen als mögliche Voraussetzung für sozial<br />
unsicheres Verhalten<br />
Aus <strong>dem</strong> oben erläuterten Ansatz mit seinen <strong>bei</strong>den „Säulen“ der<br />
Unvorhersehbarkeit <strong>und</strong> der Unkontrollierbarkeit leiten F. Petermann <strong>und</strong> U.<br />
Petermann (1994) eine mögliche Ursachenerklärung im erzieherischen<br />
Verhalten der Eltern sozial unsicherer Kinder ab, die, neben anderen<br />
Faktoren, eine wichtige Rolle spielen.<br />
Nach Rogge (1997) sind es zwei <strong>unter</strong>schiedliche Erziehungsstile, die zu<br />
sozial unsicherem Verhalten <strong>bei</strong> <strong>Kindern</strong> führen können.<br />
Laissez faire/Vernachlässigung<br />
Unter „Laissez faire“ versteht man einen Erziehungsstil, der keine Grenzen<br />
setzt, wodurch sich die Kinder oftmals überfordert fühlen (vgl. Rogge, 1997,<br />
S. 194-234). Sie lernen nicht einzuschätzen, was sie schon können <strong>und</strong> was<br />
über ihre Kompetenzen hinaus geht, weil niemand ihnen ihre Grenzen<br />
aufzeigt. Es kann zu Frustrationserlebnissen kommen, die sie nicht<br />
verar<strong>bei</strong>ten können. So fehlt ihnen Selbstvertrauen, sie ziehen sich zurück<br />
<strong>und</strong> vermeiden jeglichen sozialen Kontakt. Unvorhersehbare Ereignisse,<br />
deren Konsequenzen den <strong>Kindern</strong> nicht deutlich werden, treten häufig in<br />
22