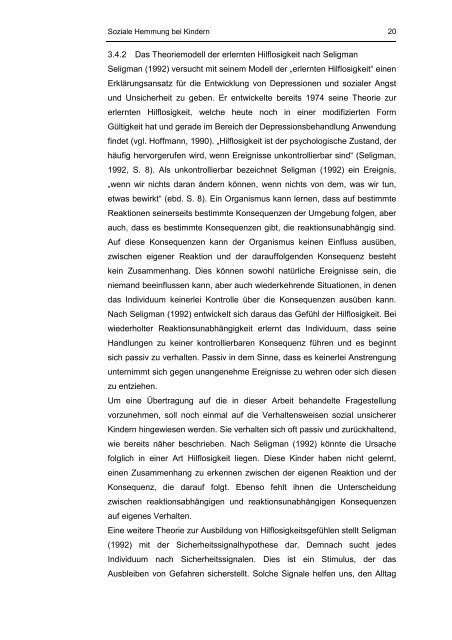Soziale Hemmung und Sprechangst bei Kindern unter dem Aspekt ...
Soziale Hemmung und Sprechangst bei Kindern unter dem Aspekt ...
Soziale Hemmung und Sprechangst bei Kindern unter dem Aspekt ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Soziale</strong> <strong>Hemmung</strong> <strong>bei</strong> <strong>Kindern</strong><br />
3.4.2 Das Theoriemodell der erlernten Hilflosigkeit nach Seligman<br />
Seligman (1992) versucht mit seinem Modell der „erlernten Hilflosigkeit“ einen<br />
Erklärungsansatz für die Entwicklung von Depressionen <strong>und</strong> sozialer Angst<br />
<strong>und</strong> Unsicherheit zu geben. Er entwickelte bereits 1974 seine Theorie zur<br />
erlernten Hilflosigkeit, welche heute noch in einer modifizierten Form<br />
Gültigkeit hat <strong>und</strong> gerade im Bereich der Depressionsbehandlung Anwendung<br />
findet (vgl. Hoffmann, 1990). „Hilflosigkeit ist der psychologische Zustand, der<br />
häufig hervorgerufen wird, wenn Ereignisse unkontrollierbar sind“ (Seligman,<br />
1992, S. 8). Als unkontrollierbar bezeichnet Seligman (1992) ein Ereignis,<br />
„wenn wir nichts daran ändern können, wenn nichts von <strong>dem</strong>, was wir tun,<br />
etwas bewirkt“ (ebd. S. 8). Ein Organismus kann lernen, dass auf bestimmte<br />
Reaktionen seinerseits bestimmte Konsequenzen der Umgebung folgen, aber<br />
auch, dass es bestimmte Konsequenzen gibt, die reaktionsunabhängig sind.<br />
Auf diese Konsequenzen kann der Organismus keinen Einfluss ausüben,<br />
zwischen eigener Reaktion <strong>und</strong> der darauffolgenden Konsequenz besteht<br />
kein Zusammenhang. Dies können sowohl natürliche Ereignisse sein, die<br />
niemand beeinflussen kann, aber auch wiederkehrende Situationen, in denen<br />
das Individuum keinerlei Kontrolle über die Konsequenzen ausüben kann.<br />
Nach Seligman (1992) entwickelt sich daraus das Gefühl der Hilflosigkeit. Bei<br />
wiederholter Reaktionsunabhängigkeit erlernt das Individuum, dass seine<br />
Handlungen zu keiner kontrollierbaren Konsequenz führen <strong>und</strong> es beginnt<br />
sich passiv zu verhalten. Passiv in <strong>dem</strong> Sinne, dass es keinerlei Anstrengung<br />
<strong>unter</strong>nimmt sich gegen unangenehme Ereignisse zu wehren oder sich diesen<br />
zu entziehen.<br />
Um eine Übertragung auf die in dieser Ar<strong>bei</strong>t behandelte Fragestellung<br />
vorzunehmen, soll noch einmal auf die Verhaltensweisen sozial unsicherer<br />
<strong>Kindern</strong> hingewiesen werden. Sie verhalten sich oft passiv <strong>und</strong> zurückhaltend,<br />
wie bereits näher beschrieben. Nach Seligman (1992) könnte die Ursache<br />
folglich in einer Art Hilflosigkeit liegen. Diese Kinder haben nicht gelernt,<br />
einen Zusammenhang zu erkennen zwischen der eigenen Reaktion <strong>und</strong> der<br />
Konsequenz, die darauf folgt. Ebenso fehlt ihnen die Unterscheidung<br />
zwischen reaktionsabhängigen <strong>und</strong> reaktionsunabhängigen Konsequenzen<br />
auf eigenes Verhalten.<br />
Eine weitere Theorie zur Ausbildung von Hilflosigkeitsgefühlen stellt Seligman<br />
(1992) mit der Sicherheitssignalhypothese dar. Demnach sucht jedes<br />
Individuum nach Sicherheitssignalen. Dies ist ein Stimulus, der das<br />
Ausbleiben von Gefahren sicherstellt. Solche Signale helfen uns, den Alltag<br />
20