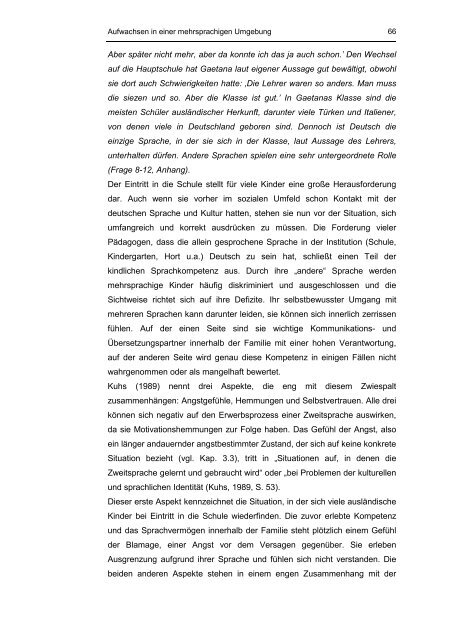Soziale Hemmung und Sprechangst bei Kindern unter dem Aspekt ...
Soziale Hemmung und Sprechangst bei Kindern unter dem Aspekt ...
Soziale Hemmung und Sprechangst bei Kindern unter dem Aspekt ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Aufwachsen in einer mehrsprachigen Umgebung<br />
Aber später nicht mehr, aber da konnte ich das ja auch schon.’ Den Wechsel<br />
auf die Hauptschule hat Gaetana laut eigener Aussage gut bewältigt, obwohl<br />
sie dort auch Schwierigkeiten hatte: ‚Die Lehrer waren so anders. Man muss<br />
die siezen <strong>und</strong> so. Aber die Klasse ist gut.’ In Gaetanas Klasse sind die<br />
meisten Schüler ausländischer Herkunft, dar<strong>unter</strong> viele Türken <strong>und</strong> Italiener,<br />
von denen viele in Deutschland geboren sind. Dennoch ist Deutsch die<br />
einzige Sprache, in der sie sich in der Klasse, laut Aussage des Lehrers,<br />
<strong>unter</strong>halten dürfen. Andere Sprachen spielen eine sehr <strong>unter</strong>geordnete Rolle<br />
(Frage 8-12, Anhang).<br />
Der Eintritt in die Schule stellt für viele Kinder eine große Herausforderung<br />
dar. Auch wenn sie vorher im sozialen Umfeld schon Kontakt mit der<br />
deutschen Sprache <strong>und</strong> Kultur hatten, stehen sie nun vor der Situation, sich<br />
umfangreich <strong>und</strong> korrekt ausdrücken zu müssen. Die Forderung vieler<br />
Pädagogen, dass die allein gesprochene Sprache in der Institution (Schule,<br />
Kindergarten, Hort u.a.) Deutsch zu sein hat, schließt einen Teil der<br />
kindlichen Sprachkompetenz aus. Durch ihre „andere“ Sprache werden<br />
mehrsprachige Kinder häufig diskriminiert <strong>und</strong> ausgeschlossen <strong>und</strong> die<br />
Sichtweise richtet sich auf ihre Defizite. Ihr selbstbewusster Umgang mit<br />
mehreren Sprachen kann dar<strong>unter</strong> leiden, sie können sich innerlich zerrissen<br />
fühlen. Auf der einen Seite sind sie wichtige Kommunikations- <strong>und</strong><br />
Übersetzungspartner innerhalb der Familie mit einer hohen Verantwortung,<br />
auf der anderen Seite wird genau diese Kompetenz in einigen Fällen nicht<br />
wahrgenommen oder als mangelhaft bewertet.<br />
Kuhs (1989) nennt drei <strong>Aspekt</strong>e, die eng mit diesem Zwiespalt<br />
zusammenhängen: Angstgefühle, <strong>Hemmung</strong>en <strong>und</strong> Selbstvertrauen. Alle drei<br />
können sich negativ auf den Erwerbsprozess einer Zweitsprache auswirken,<br />
da sie Motivationshemmungen zur Folge haben. Das Gefühl der Angst, also<br />
ein länger andauernder angstbestimmter Zustand, der sich auf keine konkrete<br />
Situation bezieht (vgl. Kap. 3.3), tritt in „Situationen auf, in denen die<br />
Zweitsprache gelernt <strong>und</strong> gebraucht wird“ oder „<strong>bei</strong> Problemen der kulturellen<br />
<strong>und</strong> sprachlichen Identität (Kuhs, 1989, S. 53).<br />
Dieser erste <strong>Aspekt</strong> kennzeichnet die Situation, in der sich viele ausländische<br />
Kinder <strong>bei</strong> Eintritt in die Schule wiederfinden. Die zuvor erlebte Kompetenz<br />
<strong>und</strong> das Sprachvermögen innerhalb der Familie steht plötzlich einem Gefühl<br />
der Blamage, einer Angst vor <strong>dem</strong> Versagen gegenüber. Sie erleben<br />
Ausgrenzung aufgr<strong>und</strong> ihrer Sprache <strong>und</strong> fühlen sich nicht verstanden. Die<br />
<strong>bei</strong>den anderen <strong>Aspekt</strong>e stehen in einem engen Zusammenhang mit der<br />
66