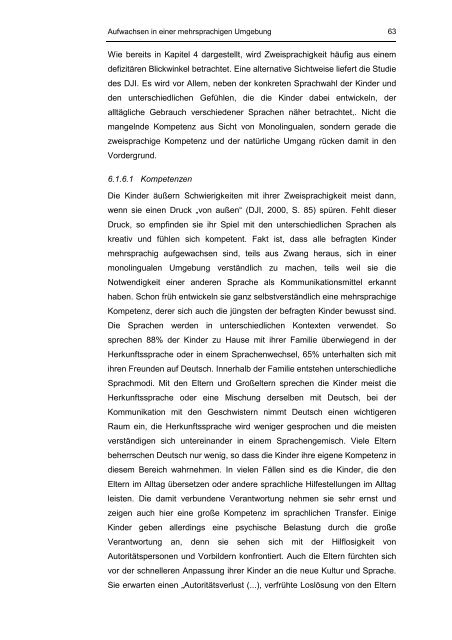Soziale Hemmung und Sprechangst bei Kindern unter dem Aspekt ...
Soziale Hemmung und Sprechangst bei Kindern unter dem Aspekt ...
Soziale Hemmung und Sprechangst bei Kindern unter dem Aspekt ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Aufwachsen in einer mehrsprachigen Umgebung<br />
Wie bereits in Kapitel 4 dargestellt, wird Zweisprachigkeit häufig aus einem<br />
defizitären Blickwinkel betrachtet. Eine alternative Sichtweise liefert die Studie<br />
des DJI. Es wird vor Allem, neben der konkreten Sprachwahl der Kinder <strong>und</strong><br />
den <strong>unter</strong>schiedlichen Gefühlen, die die Kinder da<strong>bei</strong> entwickeln, der<br />
alltägliche Gebrauch verschiedener Sprachen näher betrachtet,. Nicht die<br />
mangelnde Kompetenz aus Sicht von Monolingualen, sondern gerade die<br />
zweisprachige Kompetenz <strong>und</strong> der natürliche Umgang rücken damit in den<br />
Vordergr<strong>und</strong>.<br />
6.1.6.1 Kompetenzen<br />
Die Kinder äußern Schwierigkeiten mit ihrer Zweisprachigkeit meist dann,<br />
wenn sie einen Druck „von außen“ (DJI, 2000, S. 85) spüren. Fehlt dieser<br />
Druck, so empfinden sie ihr Spiel mit den <strong>unter</strong>schiedlichen Sprachen als<br />
kreativ <strong>und</strong> fühlen sich kompetent. Fakt ist, dass alle befragten Kinder<br />
mehrsprachig aufgewachsen sind, teils aus Zwang heraus, sich in einer<br />
monolingualen Umgebung verständlich zu machen, teils weil sie die<br />
Notwendigkeit einer anderen Sprache als Kommunikationsmittel erkannt<br />
haben. Schon früh entwickeln sie ganz selbstverständlich eine mehrsprachige<br />
Kompetenz, derer sich auch die jüngsten der befragten Kinder bewusst sind.<br />
Die Sprachen werden in <strong>unter</strong>schiedlichen Kontexten verwendet. So<br />
sprechen 88% der Kinder zu Hause mit ihrer Familie überwiegend in der<br />
Herkunftssprache oder in einem Sprachenwechsel, 65% <strong>unter</strong>halten sich mit<br />
ihren Fre<strong>und</strong>en auf Deutsch. Innerhalb der Familie entstehen <strong>unter</strong>schiedliche<br />
Sprachmodi. Mit den Eltern <strong>und</strong> Großeltern sprechen die Kinder meist die<br />
Herkunftssprache oder eine Mischung derselben mit Deutsch, <strong>bei</strong> der<br />
Kommunikation mit den Geschwistern nimmt Deutsch einen wichtigeren<br />
Raum ein, die Herkunftssprache wird weniger gesprochen <strong>und</strong> die meisten<br />
verständigen sich <strong>unter</strong>einander in einem Sprachengemisch. Viele Eltern<br />
beherrschen Deutsch nur wenig, so dass die Kinder ihre eigene Kompetenz in<br />
diesem Bereich wahrnehmen. In vielen Fällen sind es die Kinder, die den<br />
Eltern im Alltag übersetzen oder andere sprachliche Hilfestellungen im Alltag<br />
leisten. Die damit verb<strong>und</strong>ene Verantwortung nehmen sie sehr ernst <strong>und</strong><br />
zeigen auch hier eine große Kompetenz im sprachlichen Transfer. Einige<br />
Kinder geben allerdings eine psychische Belastung durch die große<br />
Verantwortung an, denn sie sehen sich mit der Hilflosigkeit von<br />
Autoritätspersonen <strong>und</strong> Vorbildern konfrontiert. Auch die Eltern fürchten sich<br />
vor der schnelleren Anpassung ihrer Kinder an die neue Kultur <strong>und</strong> Sprache.<br />
Sie erwarten einen „Autoritätsverlust (...), verfrühte Loslösung von den Eltern<br />
63