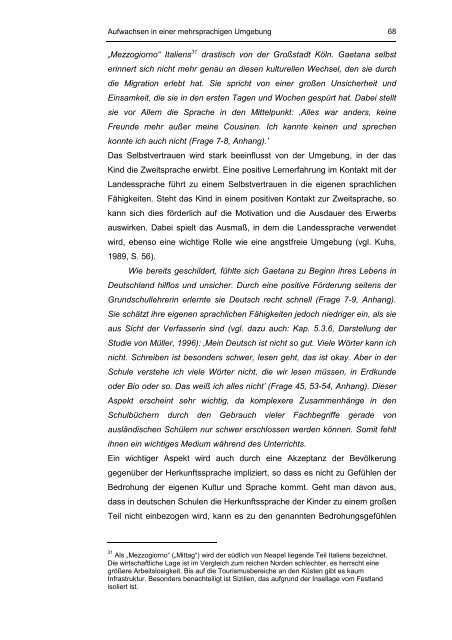Soziale Hemmung und Sprechangst bei Kindern unter dem Aspekt ...
Soziale Hemmung und Sprechangst bei Kindern unter dem Aspekt ...
Soziale Hemmung und Sprechangst bei Kindern unter dem Aspekt ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Aufwachsen in einer mehrsprachigen Umgebung<br />
„Mezzogiorno“ Italiens 31 drastisch von der Großstadt Köln. Gaetana selbst<br />
erinnert sich nicht mehr genau an diesen kulturellen Wechsel, den sie durch<br />
die Migration erlebt hat. Sie spricht von einer großen Unsicherheit <strong>und</strong><br />
Einsamkeit, die sie in den ersten Tagen <strong>und</strong> Wochen gespürt hat. Da<strong>bei</strong> stellt<br />
sie vor Allem die Sprache in den Mittelpunkt: ‚Alles war anders, keine<br />
Fre<strong>und</strong>e mehr außer meine Cousinen. Ich kannte keinen <strong>und</strong> sprechen<br />
konnte ich auch nicht (Frage 7-8, Anhang).’<br />
Das Selbstvertrauen wird stark beeinflusst von der Umgebung, in der das<br />
Kind die Zweitsprache erwirbt. Eine positive Lernerfahrung im Kontakt mit der<br />
Landessprache führt zu einem Selbstvertrauen in die eigenen sprachlichen<br />
Fähigkeiten. Steht das Kind in einem positiven Kontakt zur Zweitsprache, so<br />
kann sich dies förderlich auf die Motivation <strong>und</strong> die Ausdauer des Erwerbs<br />
auswirken. Da<strong>bei</strong> spielt das Ausmaß, in <strong>dem</strong> die Landessprache verwendet<br />
wird, ebenso eine wichtige Rolle wie eine angstfreie Umgebung (vgl. Kuhs,<br />
1989, S. 56).<br />
Wie bereits geschildert, fühlte sich Gaetana zu Beginn ihres Lebens in<br />
Deutschland hilflos <strong>und</strong> unsicher. Durch eine positive Förderung seitens der<br />
Gr<strong>und</strong>schullehrerin erlernte sie Deutsch recht schnell (Frage 7-9, Anhang).<br />
Sie schätzt ihre eigenen sprachlichen Fähigkeiten jedoch niedriger ein, als sie<br />
aus Sicht der Verfasserin sind (vgl. dazu auch: Kap. 5.3.6, Darstellung der<br />
Studie von Müller, 1996): ‚Mein Deutsch ist nicht so gut. Viele Wörter kann ich<br />
nicht. Schreiben ist besonders schwer, lesen geht, das ist okay. Aber in der<br />
Schule verstehe ich viele Wörter nicht, die wir lesen müssen, in Erdk<strong>und</strong>e<br />
oder Bio oder so. Das weiß ich alles nicht’ (Frage 45, 53-54, Anhang). Dieser<br />
<strong>Aspekt</strong> erscheint sehr wichtig, da komplexere Zusammenhänge in den<br />
Schulbüchern durch den Gebrauch vieler Fachbegriffe gerade von<br />
ausländischen Schülern nur schwer erschlossen werden können. Somit fehlt<br />
ihnen ein wichtiges Medium während des Unterrichts.<br />
Ein wichtiger <strong>Aspekt</strong> wird auch durch eine Akzeptanz der Bevölkerung<br />
gegenüber der Herkunftssprache impliziert, so dass es nicht zu Gefühlen der<br />
Bedrohung der eigenen Kultur <strong>und</strong> Sprache kommt. Geht man davon aus,<br />
dass in deutschen Schulen die Herkunftssprache der Kinder zu einem großen<br />
Teil nicht einbezogen wird, kann es zu den genannten Bedrohungsgefühlen<br />
31 Als „Mezzogiorno“ („Mittag“) wird der südlich von Neapel liegende Teil Italiens bezeichnet.<br />
Die wirtschaftliche Lage ist im Vergleich zum reichen Norden schlechter, es herrscht eine<br />
größere Ar<strong>bei</strong>tslosigkeit. Bis auf die Tourismusbereiche an den Küsten gibt es kaum<br />
Infrastruktur. Besonders benachteiligt ist Sizilien, das aufgr<strong>und</strong> der Insellage vom Festland<br />
isoliert ist.<br />
68