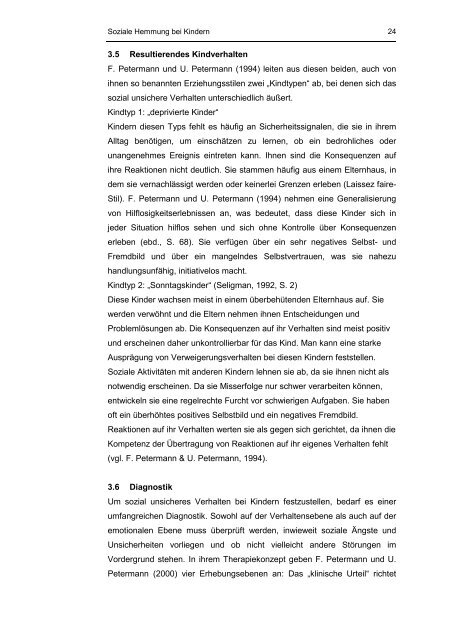Soziale Hemmung und Sprechangst bei Kindern unter dem Aspekt ...
Soziale Hemmung und Sprechangst bei Kindern unter dem Aspekt ...
Soziale Hemmung und Sprechangst bei Kindern unter dem Aspekt ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Soziale</strong> <strong>Hemmung</strong> <strong>bei</strong> <strong>Kindern</strong><br />
3.5 Resultierendes Kindverhalten<br />
F. Petermann <strong>und</strong> U. Petermann (1994) leiten aus diesen <strong>bei</strong>den, auch von<br />
ihnen so benannten Erziehungsstilen zwei „Kindtypen“ ab, <strong>bei</strong> denen sich das<br />
sozial unsichere Verhalten <strong>unter</strong>schiedlich äußert.<br />
Kindtyp 1: „deprivierte Kinder“<br />
<strong>Kindern</strong> diesen Typs fehlt es häufig an Sicherheitssignalen, die sie in ihrem<br />
Alltag benötigen, um einschätzen zu lernen, ob ein bedrohliches oder<br />
unangenehmes Ereignis eintreten kann. Ihnen sind die Konsequenzen auf<br />
ihre Reaktionen nicht deutlich. Sie stammen häufig aus einem Elternhaus, in<br />
<strong>dem</strong> sie vernachlässigt werden oder keinerlei Grenzen erleben (Laissez faire-<br />
Stil). F. Petermann <strong>und</strong> U. Petermann (1994) nehmen eine Generalisierung<br />
von Hilflosigkeitserlebnissen an, was bedeutet, dass diese Kinder sich in<br />
jeder Situation hilflos sehen <strong>und</strong> sich ohne Kontrolle über Konsequenzen<br />
erleben (ebd., S. 68). Sie verfügen über ein sehr negatives Selbst- <strong>und</strong><br />
Fremdbild <strong>und</strong> über ein mangelndes Selbstvertrauen, was sie nahezu<br />
handlungsunfähig, initiativelos macht.<br />
Kindtyp 2: „Sonntagskinder“ (Seligman, 1992, S. 2)<br />
Diese Kinder wachsen meist in einem überbehütenden Elternhaus auf. Sie<br />
werden verwöhnt <strong>und</strong> die Eltern nehmen ihnen Entscheidungen <strong>und</strong><br />
Problemlösungen ab. Die Konsequenzen auf ihr Verhalten sind meist positiv<br />
<strong>und</strong> erscheinen daher unkontrollierbar für das Kind. Man kann eine starke<br />
Ausprägung von Verweigerungsverhalten <strong>bei</strong> diesen <strong>Kindern</strong> feststellen.<br />
<strong>Soziale</strong> Aktivitäten mit anderen <strong>Kindern</strong> lehnen sie ab, da sie ihnen nicht als<br />
notwendig erscheinen. Da sie Misserfolge nur schwer verar<strong>bei</strong>ten können,<br />
entwickeln sie eine regelrechte Furcht vor schwierigen Aufgaben. Sie haben<br />
oft ein überhöhtes positives Selbstbild <strong>und</strong> ein negatives Fremdbild.<br />
Reaktionen auf ihr Verhalten werten sie als gegen sich gerichtet, da ihnen die<br />
Kompetenz der Übertragung von Reaktionen auf ihr eigenes Verhalten fehlt<br />
(vgl. F. Petermann & U. Petermann, 1994).<br />
3.6 Diagnostik<br />
Um sozial unsicheres Verhalten <strong>bei</strong> <strong>Kindern</strong> festzustellen, bedarf es einer<br />
umfangreichen Diagnostik. Sowohl auf der Verhaltensebene als auch auf der<br />
emotionalen Ebene muss überprüft werden, inwieweit soziale Ängste <strong>und</strong><br />
Unsicherheiten vorliegen <strong>und</strong> ob nicht vielleicht andere Störungen im<br />
Vordergr<strong>und</strong> stehen. In ihrem Therapiekonzept geben F. Petermann <strong>und</strong> U.<br />
Petermann (2000) vier Erhebungsebenen an: Das „klinische Urteil“ richtet<br />
24