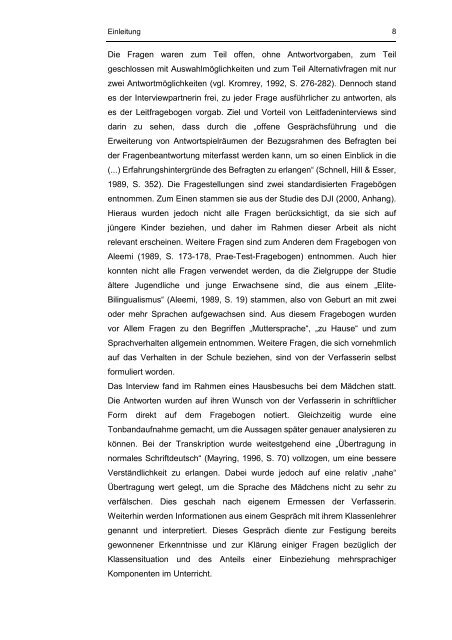Soziale Hemmung und Sprechangst bei Kindern unter dem Aspekt ...
Soziale Hemmung und Sprechangst bei Kindern unter dem Aspekt ...
Soziale Hemmung und Sprechangst bei Kindern unter dem Aspekt ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Einleitung<br />
Die Fragen waren zum Teil offen, ohne Antwortvorgaben, zum Teil<br />
geschlossen mit Auswahlmöglichkeiten <strong>und</strong> zum Teil Alternativfragen mit nur<br />
zwei Antwortmöglichkeiten (vgl. Kromrey, 1992, S. 276-282). Dennoch stand<br />
es der Interviewpartnerin frei, zu jeder Frage ausführlicher zu antworten, als<br />
es der Leitfragebogen vorgab. Ziel <strong>und</strong> Vorteil von Leitfadeninterviews sind<br />
darin zu sehen, dass durch die „offene Gesprächsführung <strong>und</strong> die<br />
Erweiterung von Antwortspielräumen der Bezugsrahmen des Befragten <strong>bei</strong><br />
der Fragenbeantwortung miterfasst werden kann, um so einen Einblick in die<br />
(...) Erfahrungshintergründe des Befragten zu erlangen“ (Schnell, Hill & Esser,<br />
1989, S. 352). Die Fragestellungen sind zwei standardisierten Fragebögen<br />
entnommen. Zum Einen stammen sie aus der Studie des DJI (2000, Anhang).<br />
Hieraus wurden jedoch nicht alle Fragen berücksichtigt, da sie sich auf<br />
jüngere Kinder beziehen, <strong>und</strong> daher im Rahmen dieser Ar<strong>bei</strong>t als nicht<br />
relevant erscheinen. Weitere Fragen sind zum Anderen <strong>dem</strong> Fragebogen von<br />
Aleemi (1989, S. 173-178, Prae-Test-Fragebogen) entnommen. Auch hier<br />
konnten nicht alle Fragen verwendet werden, da die Zielgruppe der Studie<br />
ältere Jugendliche <strong>und</strong> junge Erwachsene sind, die aus einem „Elite-<br />
Bilingualismus“ (Aleemi, 1989, S. 19) stammen, also von Geburt an mit zwei<br />
oder mehr Sprachen aufgewachsen sind. Aus diesem Fragebogen wurden<br />
vor Allem Fragen zu den Begriffen „Muttersprache“, „zu Hause“ <strong>und</strong> zum<br />
Sprachverhalten allgemein entnommen. Weitere Fragen, die sich vornehmlich<br />
auf das Verhalten in der Schule beziehen, sind von der Verfasserin selbst<br />
formuliert worden.<br />
Das Interview fand im Rahmen eines Hausbesuchs <strong>bei</strong> <strong>dem</strong> Mädchen statt.<br />
Die Antworten wurden auf ihren Wunsch von der Verfasserin in schriftlicher<br />
Form direkt auf <strong>dem</strong> Fragebogen notiert. Gleichzeitig wurde eine<br />
Tonbandaufnahme gemacht, um die Aussagen später genauer analysieren zu<br />
können. Bei der Transkription wurde weitestgehend eine „Übertragung in<br />
normales Schriftdeutsch“ (Mayring, 1996, S. 70) vollzogen, um eine bessere<br />
Verständlichkeit zu erlangen. Da<strong>bei</strong> wurde jedoch auf eine relativ „nahe“<br />
Übertragung wert gelegt, um die Sprache des Mädchens nicht zu sehr zu<br />
verfälschen. Dies geschah nach eigenem Ermessen der Verfasserin.<br />
Weiterhin werden Informationen aus einem Gespräch mit ihrem Klassenlehrer<br />
genannt <strong>und</strong> interpretiert. Dieses Gespräch diente zur Festigung bereits<br />
gewonnener Erkenntnisse <strong>und</strong> zur Klärung einiger Fragen bezüglich der<br />
Klassensituation <strong>und</strong> des Anteils einer Einbeziehung mehrsprachiger<br />
Komponenten im Unterricht.<br />
8