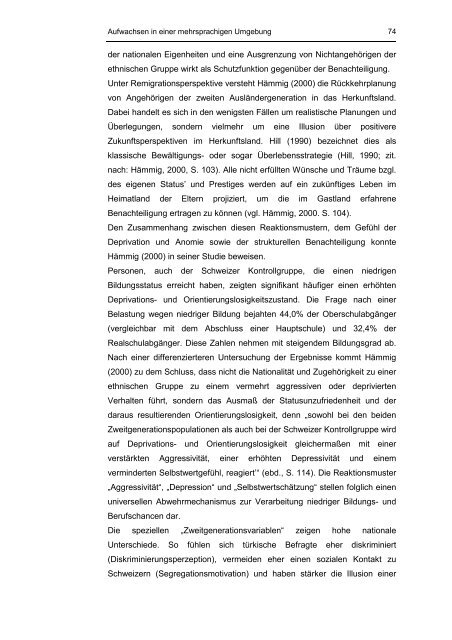Soziale Hemmung und Sprechangst bei Kindern unter dem Aspekt ...
Soziale Hemmung und Sprechangst bei Kindern unter dem Aspekt ...
Soziale Hemmung und Sprechangst bei Kindern unter dem Aspekt ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Aufwachsen in einer mehrsprachigen Umgebung<br />
der nationalen Eigenheiten <strong>und</strong> eine Ausgrenzung von Nichtangehörigen der<br />
ethnischen Gruppe wirkt als Schutzfunktion gegenüber der Benachteiligung.<br />
Unter Remigrationsperspektive versteht Hämmig (2000) die Rückkehrplanung<br />
von Angehörigen der zweiten Ausländergeneration in das Herkunftsland.<br />
Da<strong>bei</strong> handelt es sich in den wenigsten Fällen um realistische Planungen <strong>und</strong><br />
Überlegungen, sondern vielmehr um eine Illusion über positivere<br />
Zukunftsperspektiven im Herkunftsland. Hill (1990) bezeichnet dies als<br />
klassische Bewältigungs- oder sogar Überlebensstrategie (Hill, 1990; zit.<br />
nach: Hämmig, 2000, S. 103). Alle nicht erfüllten Wünsche <strong>und</strong> Träume bzgl.<br />
des eigenen Status’ <strong>und</strong> Prestiges werden auf ein zukünftiges Leben im<br />
Heimatland der Eltern projiziert, um die im Gastland erfahrene<br />
Benachteiligung ertragen zu können (vgl. Hämmig, 2000. S. 104).<br />
Den Zusammenhang zwischen diesen Reaktionsmustern, <strong>dem</strong> Gefühl der<br />
Deprivation <strong>und</strong> Anomie sowie der strukturellen Benachteiligung konnte<br />
Hämmig (2000) in seiner Studie beweisen.<br />
Personen, auch der Schweizer Kontrollgruppe, die einen niedrigen<br />
Bildungsstatus erreicht haben, zeigten signifikant häufiger einen erhöhten<br />
Deprivations- <strong>und</strong> Orientierungslosigkeitszustand. Die Frage nach einer<br />
Belastung wegen niedriger Bildung bejahten 44,0% der Oberschulabgänger<br />
(vergleichbar mit <strong>dem</strong> Abschluss einer Hauptschule) <strong>und</strong> 32,4% der<br />
Realschulabgänger. Diese Zahlen nehmen mit steigen<strong>dem</strong> Bildungsgrad ab.<br />
Nach einer differenzierteren Untersuchung der Ergebnisse kommt Hämmig<br />
(2000) zu <strong>dem</strong> Schluss, dass nicht die Nationalität <strong>und</strong> Zugehörigkeit zu einer<br />
ethnischen Gruppe zu einem vermehrt aggressiven oder deprivierten<br />
Verhalten führt, sondern das Ausmaß der Statusunzufriedenheit <strong>und</strong> der<br />
daraus resultierenden Orientierungslosigkeit, denn „sowohl <strong>bei</strong> den <strong>bei</strong>den<br />
Zweitgenerationspopulationen als auch <strong>bei</strong> der Schweizer Kontrollgruppe wird<br />
auf Deprivations- <strong>und</strong> Orientierungslosigkeit gleichermaßen mit einer<br />
verstärkten Aggressivität, einer erhöhten Depressivität <strong>und</strong> einem<br />
verminderten Selbstwertgefühl, reagiert’“ (ebd., S. 114). Die Reaktionsmuster<br />
„Aggressivität“, „Depression“ <strong>und</strong> „Selbstwertschätzung“ stellen folglich einen<br />
universellen Abwehrmechanismus zur Verar<strong>bei</strong>tung niedriger Bildungs- <strong>und</strong><br />
Berufschancen dar.<br />
Die speziellen „Zweitgenerationsvariablen“ zeigen hohe nationale<br />
Unterschiede. So fühlen sich türkische Befragte eher diskriminiert<br />
(Diskriminierungsperzeption), vermeiden eher einen sozialen Kontakt zu<br />
Schweizern (Segregationsmotivation) <strong>und</strong> haben stärker die Illusion einer<br />
74