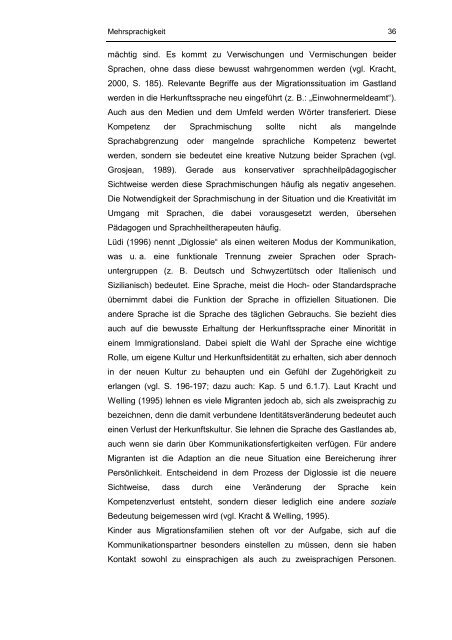Soziale Hemmung und Sprechangst bei Kindern unter dem Aspekt ...
Soziale Hemmung und Sprechangst bei Kindern unter dem Aspekt ...
Soziale Hemmung und Sprechangst bei Kindern unter dem Aspekt ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Mehrsprachigkeit<br />
mächtig sind. Es kommt zu Verwischungen <strong>und</strong> Vermischungen <strong>bei</strong>der<br />
Sprachen, ohne dass diese bewusst wahrgenommen werden (vgl. Kracht,<br />
2000, S. 185). Relevante Begriffe aus der Migrationssituation im Gastland<br />
werden in die Herkunftssprache neu eingeführt (z. B.: „Einwohnermeldeamt“).<br />
Auch aus den Medien <strong>und</strong> <strong>dem</strong> Umfeld werden Wörter transferiert. Diese<br />
Kompetenz der Sprachmischung sollte nicht als mangelnde<br />
Sprachabgrenzung oder mangelnde sprachliche Kompetenz bewertet<br />
werden, sondern sie bedeutet eine kreative Nutzung <strong>bei</strong>der Sprachen (vgl.<br />
Grosjean, 1989). Gerade aus konservativer sprachheilpädagogischer<br />
Sichtweise werden diese Sprachmischungen häufig als negativ angesehen.<br />
Die Notwendigkeit der Sprachmischung in der Situation <strong>und</strong> die Kreativität im<br />
Umgang mit Sprachen, die da<strong>bei</strong> vorausgesetzt werden, übersehen<br />
Pädagogen <strong>und</strong> Sprachheiltherapeuten häufig.<br />
Lüdi (1996) nennt „Diglossie“ als einen weiteren Modus der Kommunikation,<br />
was u. a. eine funktionale Trennung zweier Sprachen oder Sprach<strong>unter</strong>gruppen<br />
(z. B. Deutsch <strong>und</strong> Schwyzertütsch oder Italienisch <strong>und</strong><br />
Sizilianisch) bedeutet. Eine Sprache, meist die Hoch- oder Standardsprache<br />
übernimmt da<strong>bei</strong> die Funktion der Sprache in offiziellen Situationen. Die<br />
andere Sprache ist die Sprache des täglichen Gebrauchs. Sie bezieht dies<br />
auch auf die bewusste Erhaltung der Herkunftssprache einer Minorität in<br />
einem Immigrationsland. Da<strong>bei</strong> spielt die Wahl der Sprache eine wichtige<br />
Rolle, um eigene Kultur <strong>und</strong> Herkunftsidentität zu erhalten, sich aber dennoch<br />
in der neuen Kultur zu behaupten <strong>und</strong> ein Gefühl der Zugehörigkeit zu<br />
erlangen (vgl. S. 196-197; dazu auch: Kap. 5 <strong>und</strong> 6.1.7). Laut Kracht <strong>und</strong><br />
Welling (1995) lehnen es viele Migranten jedoch ab, sich als zweisprachig zu<br />
bezeichnen, denn die damit verb<strong>und</strong>ene Identitätsveränderung bedeutet auch<br />
einen Verlust der Herkunftskultur. Sie lehnen die Sprache des Gastlandes ab,<br />
auch wenn sie darin über Kommunikationsfertigkeiten verfügen. Für andere<br />
Migranten ist die Adaption an die neue Situation eine Bereicherung ihrer<br />
Persönlichkeit. Entscheidend in <strong>dem</strong> Prozess der Diglossie ist die neuere<br />
Sichtweise, dass durch eine Veränderung der Sprache kein<br />
Kompetenzverlust entsteht, sondern dieser lediglich eine andere soziale<br />
Bedeutung <strong>bei</strong>gemessen wird (vgl. Kracht & Welling, 1995).<br />
Kinder aus Migrationsfamilien stehen oft vor der Aufgabe, sich auf die<br />
Kommunikationspartner besonders einstellen zu müssen, denn sie haben<br />
Kontakt sowohl zu einsprachigen als auch zu zweisprachigen Personen.<br />
36