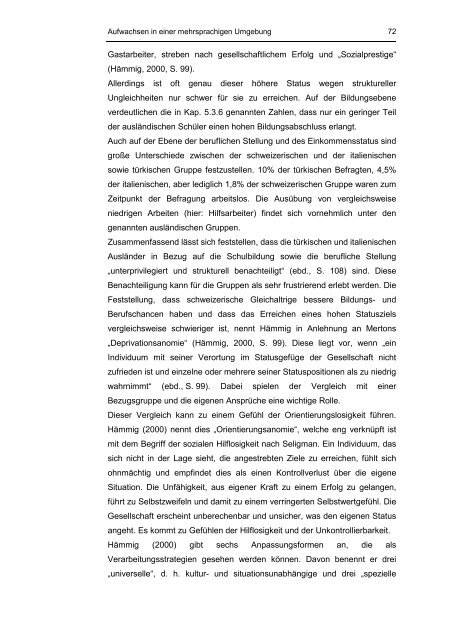Soziale Hemmung und Sprechangst bei Kindern unter dem Aspekt ...
Soziale Hemmung und Sprechangst bei Kindern unter dem Aspekt ...
Soziale Hemmung und Sprechangst bei Kindern unter dem Aspekt ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Aufwachsen in einer mehrsprachigen Umgebung<br />
Gastar<strong>bei</strong>ter, streben nach gesellschaftlichem Erfolg <strong>und</strong> „Sozialprestige“<br />
(Hämmig, 2000, S. 99).<br />
Allerdings ist oft genau dieser höhere Status wegen struktureller<br />
Ungleichheiten nur schwer für sie zu erreichen. Auf der Bildungsebene<br />
verdeutlichen die in Kap. 5.3.6 genannten Zahlen, dass nur ein geringer Teil<br />
der ausländischen Schüler einen hohen Bildungsabschluss erlangt.<br />
Auch auf der Ebene der beruflichen Stellung <strong>und</strong> des Einkommensstatus sind<br />
große Unterschiede zwischen der schweizerischen <strong>und</strong> der italienischen<br />
sowie türkischen Gruppe festzustellen. 10% der türkischen Befragten, 4,5%<br />
der italienischen, aber lediglich 1,8% der schweizerischen Gruppe waren zum<br />
Zeitpunkt der Befragung ar<strong>bei</strong>tslos. Die Ausübung von vergleichsweise<br />
niedrigen Ar<strong>bei</strong>ten (hier: Hilfsar<strong>bei</strong>ter) findet sich vornehmlich <strong>unter</strong> den<br />
genannten ausländischen Gruppen.<br />
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die türkischen <strong>und</strong> italienischen<br />
Ausländer in Bezug auf die Schulbildung sowie die berufliche Stellung<br />
„<strong>unter</strong>privilegiert <strong>und</strong> strukturell benachteiligt“ (ebd., S. 108) sind. Diese<br />
Benachteiligung kann für die Gruppen als sehr frustrierend erlebt werden. Die<br />
Feststellung, dass schweizerische Gleichaltrige bessere Bildungs- <strong>und</strong><br />
Berufschancen haben <strong>und</strong> dass das Erreichen eines hohen Statusziels<br />
vergleichsweise schwieriger ist, nennt Hämmig in Anlehnung an Mertons<br />
„Deprivationsanomie“ (Hämmig, 2000, S. 99). Diese liegt vor, wenn „ein<br />
Individuum mit seiner Verortung im Statusgefüge der Gesellschaft nicht<br />
zufrieden ist <strong>und</strong> einzelne oder mehrere seiner Statuspositionen als zu niedrig<br />
wahrnimmt“ (ebd., S. 99). Da<strong>bei</strong> spielen der Vergleich mit einer<br />
Bezugsgruppe <strong>und</strong> die eigenen Ansprüche eine wichtige Rolle.<br />
Dieser Vergleich kann zu einem Gefühl der Orientierungslosigkeit führen.<br />
Hämmig (2000) nennt dies „Orientierungsanomie“, welche eng verknüpft ist<br />
mit <strong>dem</strong> Begriff der sozialen Hilflosigkeit nach Seligman. Ein Individuum, das<br />
sich nicht in der Lage sieht, die angestrebten Ziele zu erreichen, fühlt sich<br />
ohnmächtig <strong>und</strong> empfindet dies als einen Kontrollverlust über die eigene<br />
Situation. Die Unfähigkeit, aus eigener Kraft zu einem Erfolg zu gelangen,<br />
führt zu Selbstzweifeln <strong>und</strong> damit zu einem verringerten Selbstwertgefühl. Die<br />
Gesellschaft erscheint unberechenbar <strong>und</strong> unsicher, was den eigenen Status<br />
angeht. Es kommt zu Gefühlen der Hilflosigkeit <strong>und</strong> der Unkontrollierbarkeit.<br />
Hämmig (2000) gibt sechs Anpassungsformen an, die als<br />
Verar<strong>bei</strong>tungsstrategien gesehen werden können. Davon benennt er drei<br />
„universelle“, d. h. kultur- <strong>und</strong> situationsunabhängige <strong>und</strong> drei „spezielle<br />
72