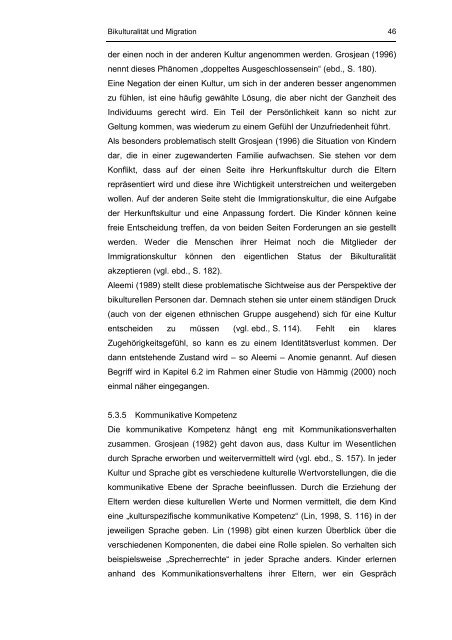Soziale Hemmung und Sprechangst bei Kindern unter dem Aspekt ...
Soziale Hemmung und Sprechangst bei Kindern unter dem Aspekt ...
Soziale Hemmung und Sprechangst bei Kindern unter dem Aspekt ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Bikulturalität <strong>und</strong> Migration<br />
der einen noch in der anderen Kultur angenommen werden. Grosjean (1996)<br />
nennt dieses Phänomen „doppeltes Ausgeschlossensein“ (ebd., S. 180).<br />
Eine Negation der einen Kultur, um sich in der anderen besser angenommen<br />
zu fühlen, ist eine häufig gewählte Lösung, die aber nicht der Ganzheit des<br />
Individuums gerecht wird. Ein Teil der Persönlichkeit kann so nicht zur<br />
Geltung kommen, was wiederum zu einem Gefühl der Unzufriedenheit führt.<br />
Als besonders problematisch stellt Grosjean (1996) die Situation von <strong>Kindern</strong><br />
dar, die in einer zugewanderten Familie aufwachsen. Sie stehen vor <strong>dem</strong><br />
Konflikt, dass auf der einen Seite ihre Herkunftskultur durch die Eltern<br />
repräsentiert wird <strong>und</strong> diese ihre Wichtigkeit <strong>unter</strong>streichen <strong>und</strong> weitergeben<br />
wollen. Auf der anderen Seite steht die Immigrationskultur, die eine Aufgabe<br />
der Herkunftskultur <strong>und</strong> eine Anpassung fordert. Die Kinder können keine<br />
freie Entscheidung treffen, da von <strong>bei</strong>den Seiten Forderungen an sie gestellt<br />
werden. Weder die Menschen ihrer Heimat noch die Mitglieder der<br />
Immigrationskultur können den eigentlichen Status der Bikulturalität<br />
akzeptieren (vgl. ebd., S. 182).<br />
Aleemi (1989) stellt diese problematische Sichtweise aus der Perspektive der<br />
bikulturellen Personen dar. Demnach stehen sie <strong>unter</strong> einem ständigen Druck<br />
(auch von der eigenen ethnischen Gruppe ausgehend) sich für eine Kultur<br />
entscheiden zu müssen (vgl. ebd., S. 114). Fehlt ein klares<br />
Zugehörigkeitsgefühl, so kann es zu einem Identitätsverlust kommen. Der<br />
dann entstehende Zustand wird – so Aleemi – Anomie genannt. Auf diesen<br />
Begriff wird in Kapitel 6.2 im Rahmen einer Studie von Hämmig (2000) noch<br />
einmal näher eingegangen.<br />
5.3.5 Kommunikative Kompetenz<br />
Die kommunikative Kompetenz hängt eng mit Kommunikationsverhalten<br />
zusammen. Grosjean (1982) geht davon aus, dass Kultur im Wesentlichen<br />
durch Sprache erworben <strong>und</strong> weitervermittelt wird (vgl. ebd., S. 157). In jeder<br />
Kultur <strong>und</strong> Sprache gibt es verschiedene kulturelle Wertvorstellungen, die die<br />
kommunikative Ebene der Sprache beeinflussen. Durch die Erziehung der<br />
Eltern werden diese kulturellen Werte <strong>und</strong> Normen vermittelt, die <strong>dem</strong> Kind<br />
eine „kulturspezifische kommunikative Kompetenz“ (Lin, 1998, S. 116) in der<br />
jeweiligen Sprache geben. Lin (1998) gibt einen kurzen Überblick über die<br />
verschiedenen Komponenten, die da<strong>bei</strong> eine Rolle spielen. So verhalten sich<br />
<strong>bei</strong>spielsweise „Sprecherrechte“ in jeder Sprache anders. Kinder erlernen<br />
anhand des Kommunikationsverhaltens ihrer Eltern, wer ein Gespräch<br />
46