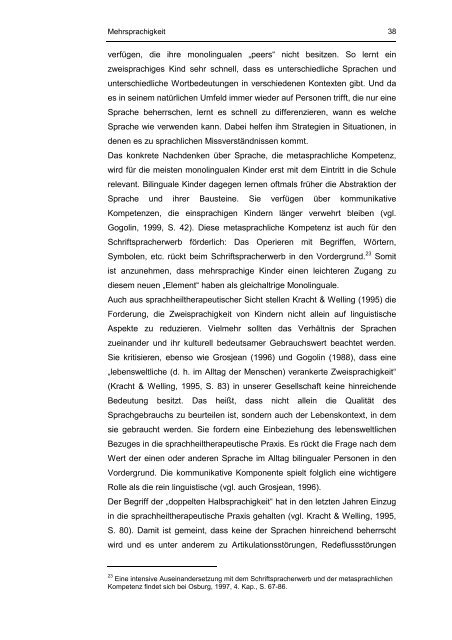Soziale Hemmung und Sprechangst bei Kindern unter dem Aspekt ...
Soziale Hemmung und Sprechangst bei Kindern unter dem Aspekt ...
Soziale Hemmung und Sprechangst bei Kindern unter dem Aspekt ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Mehrsprachigkeit<br />
verfügen, die ihre monolingualen „peers“ nicht besitzen. So lernt ein<br />
zweisprachiges Kind sehr schnell, dass es <strong>unter</strong>schiedliche Sprachen <strong>und</strong><br />
<strong>unter</strong>schiedliche Wortbedeutungen in verschiedenen Kontexten gibt. Und da<br />
es in seinem natürlichen Umfeld immer wieder auf Personen trifft, die nur eine<br />
Sprache beherrschen, lernt es schnell zu differenzieren, wann es welche<br />
Sprache wie verwenden kann. Da<strong>bei</strong> helfen ihm Strategien in Situationen, in<br />
denen es zu sprachlichen Missverständnissen kommt.<br />
Das konkrete Nachdenken über Sprache, die metasprachliche Kompetenz,<br />
wird für die meisten monolingualen Kinder erst mit <strong>dem</strong> Eintritt in die Schule<br />
relevant. Bilinguale Kinder dagegen lernen oftmals früher die Abstraktion der<br />
Sprache <strong>und</strong> ihrer Bausteine. Sie verfügen über kommunikative<br />
Kompetenzen, die einsprachigen <strong>Kindern</strong> länger verwehrt bleiben (vgl.<br />
Gogolin, 1999, S. 42). Diese metasprachliche Kompetenz ist auch für den<br />
Schriftspracherwerb förderlich: Das Operieren mit Begriffen, Wörtern,<br />
Symbolen, etc. rückt <strong>bei</strong>m Schriftspracherwerb in den Vordergr<strong>und</strong>. 23 Somit<br />
ist anzunehmen, dass mehrsprachige Kinder einen leichteren Zugang zu<br />
diesem neuen „Element“ haben als gleichaltrige Monolinguale.<br />
Auch aus sprachheiltherapeutischer Sicht stellen Kracht & Welling (1995) die<br />
Forderung, die Zweisprachigkeit von <strong>Kindern</strong> nicht allein auf linguistische<br />
<strong>Aspekt</strong>e zu reduzieren. Vielmehr sollten das Verhältnis der Sprachen<br />
zueinander <strong>und</strong> ihr kulturell bedeutsamer Gebrauchswert beachtet werden.<br />
Sie kritisieren, ebenso wie Grosjean (1996) <strong>und</strong> Gogolin (1988), dass eine<br />
„lebensweltliche (d. h. im Alltag der Menschen) verankerte Zweisprachigkeit“<br />
(Kracht & Welling, 1995, S. 83) in unserer Gesellschaft keine hinreichende<br />
Bedeutung besitzt. Das heißt, dass nicht allein die Qualität des<br />
Sprachgebrauchs zu beurteilen ist, sondern auch der Lebenskontext, in <strong>dem</strong><br />
sie gebraucht werden. Sie fordern eine Einbeziehung des lebensweltlichen<br />
Bezuges in die sprachheiltherapeutische Praxis. Es rückt die Frage nach <strong>dem</strong><br />
Wert der einen oder anderen Sprache im Alltag bilingualer Personen in den<br />
Vordergr<strong>und</strong>. Die kommunikative Komponente spielt folglich eine wichtigere<br />
Rolle als die rein linguistische (vgl. auch Grosjean, 1996).<br />
Der Begriff der „doppelten Halbsprachigkeit“ hat in den letzten Jahren Einzug<br />
in die sprachheiltherapeutische Praxis gehalten (vgl. Kracht & Welling, 1995,<br />
S. 80). Damit ist gemeint, dass keine der Sprachen hinreichend beherrscht<br />
wird <strong>und</strong> es <strong>unter</strong> anderem zu Artikulationsstörungen, Redeflussstörungen<br />
23 Eine intensive Auseinandersetzung mit <strong>dem</strong> Schriftspracherwerb <strong>und</strong> der metasprachlichen<br />
Kompetenz findet sich <strong>bei</strong> Osburg, 1997, 4. Kap., S. 67-86.<br />
38