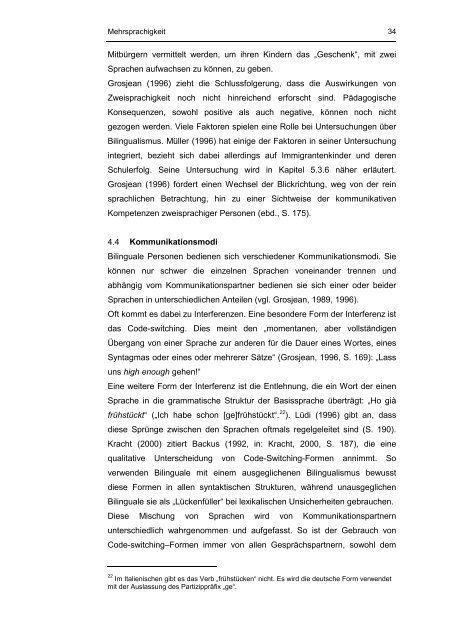Soziale Hemmung und Sprechangst bei Kindern unter dem Aspekt ...
Soziale Hemmung und Sprechangst bei Kindern unter dem Aspekt ...
Soziale Hemmung und Sprechangst bei Kindern unter dem Aspekt ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Mehrsprachigkeit<br />
Mitbürgern vermittelt werden, um ihren <strong>Kindern</strong> das „Geschenk“, mit zwei<br />
Sprachen aufwachsen zu können, zu geben.<br />
Grosjean (1996) zieht die Schlussfolgerung, dass die Auswirkungen von<br />
Zweisprachigkeit noch nicht hinreichend erforscht sind. Pädagogische<br />
Konsequenzen, sowohl positive als auch negative, können noch nicht<br />
gezogen werden. Viele Faktoren spielen eine Rolle <strong>bei</strong> Untersuchungen über<br />
Bilingualismus. Müller (1996) hat einige der Faktoren in seiner Untersuchung<br />
integriert, bezieht sich da<strong>bei</strong> allerdings auf Immigrantenkinder <strong>und</strong> deren<br />
Schulerfolg. Seine Untersuchung wird in Kapitel 5.3.6 näher erläutert.<br />
Grosjean (1996) fordert einen Wechsel der Blickrichtung, weg von der rein<br />
sprachlichen Betrachtung, hin zu einer Sichtweise der kommunikativen<br />
Kompetenzen zweisprachiger Personen (ebd., S. 175).<br />
4.4 Kommunikationsmodi<br />
Bilinguale Personen bedienen sich verschiedener Kommunikationsmodi. Sie<br />
können nur schwer die einzelnen Sprachen voneinander trennen <strong>und</strong><br />
abhängig vom Kommunikationspartner bedienen sie sich einer oder <strong>bei</strong>der<br />
Sprachen in <strong>unter</strong>schiedlichen Anteilen (vgl. Grosjean, 1989, 1996).<br />
Oft kommt es da<strong>bei</strong> zu Interferenzen. Eine besondere Form der Interferenz ist<br />
das Code-switching. Dies meint den „momentanen, aber vollständigen<br />
Übergang von einer Sprache zur anderen für die Dauer eines Wortes, eines<br />
Syntagmas oder eines oder mehrerer Sätze“ (Grosjean, 1996, S. 169): „Lass<br />
uns high enough gehen!“<br />
Eine weitere Form der Interferenz ist die Entlehnung, die ein Wort der einen<br />
Sprache in die grammatische Struktur der Basissprache überträgt: „Ho già<br />
frühstückt“ („Ich habe schon [ge]frühstückt“. 22 ). Lüdi (1996) gibt an, dass<br />
diese Sprünge zwischen den Sprachen oftmals regelgeleitet sind (S. 190).<br />
Kracht (2000) zitiert Backus (1992, in: Kracht, 2000, S. 187), die eine<br />
qualitative Unterscheidung von Code-Switching-Formen annimmt. So<br />
verwenden Bilinguale mit einem ausgeglichenen Bilingualismus bewusst<br />
diese Formen in allen syntaktischen Strukturen, während unausgeglichen<br />
Bilinguale sie als „Lückenfüller“ <strong>bei</strong> lexikalischen Unsicherheiten gebrauchen.<br />
Diese Mischung von Sprachen wird von Kommunikationspartnern<br />
<strong>unter</strong>schiedlich wahrgenommen <strong>und</strong> aufgefasst. So ist der Gebrauch von<br />
Code-switching–Formen immer von allen Gesprächspartnern, sowohl <strong>dem</strong><br />
22<br />
Im Italienischen gibt es das Verb „frühstücken“ nicht. Es wird die deutsche Form verwendet<br />
mit der Auslassung des Partizippräfix „ge“.<br />
34