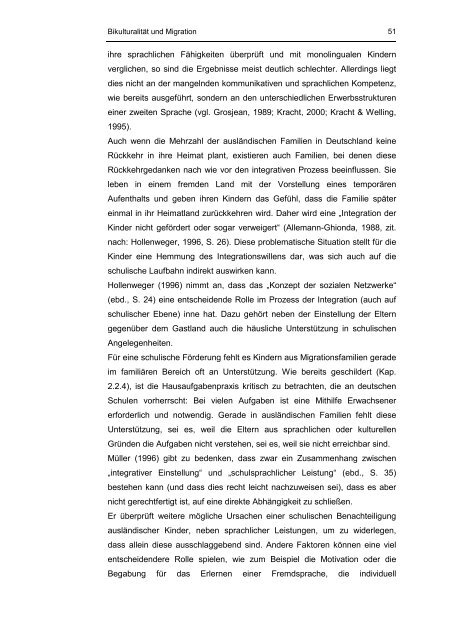Soziale Hemmung und Sprechangst bei Kindern unter dem Aspekt ...
Soziale Hemmung und Sprechangst bei Kindern unter dem Aspekt ...
Soziale Hemmung und Sprechangst bei Kindern unter dem Aspekt ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Bikulturalität <strong>und</strong> Migration<br />
ihre sprachlichen Fähigkeiten überprüft <strong>und</strong> mit monolingualen <strong>Kindern</strong><br />
verglichen, so sind die Ergebnisse meist deutlich schlechter. Allerdings liegt<br />
dies nicht an der mangelnden kommunikativen <strong>und</strong> sprachlichen Kompetenz,<br />
wie bereits ausgeführt, sondern an den <strong>unter</strong>schiedlichen Erwerbsstrukturen<br />
einer zweiten Sprache (vgl. Grosjean, 1989; Kracht, 2000; Kracht & Welling,<br />
1995).<br />
Auch wenn die Mehrzahl der ausländischen Familien in Deutschland keine<br />
Rückkehr in ihre Heimat plant, existieren auch Familien, <strong>bei</strong> denen diese<br />
Rückkehrgedanken nach wie vor den integrativen Prozess beeinflussen. Sie<br />
leben in einem fremden Land mit der Vorstellung eines temporären<br />
Aufenthalts <strong>und</strong> geben ihren <strong>Kindern</strong> das Gefühl, dass die Familie später<br />
einmal in ihr Heimatland zurückkehren wird. Daher wird eine „Integration der<br />
Kinder nicht gefördert oder sogar verweigert“ (Allemann-Ghionda, 1988, zit.<br />
nach: Hollenweger, 1996, S. 26). Diese problematische Situation stellt für die<br />
Kinder eine <strong>Hemmung</strong> des Integrationswillens dar, was sich auch auf die<br />
schulische Laufbahn indirekt auswirken kann.<br />
Hollenweger (1996) nimmt an, dass das „Konzept der sozialen Netzwerke“<br />
(ebd., S. 24) eine entscheidende Rolle im Prozess der Integration (auch auf<br />
schulischer Ebene) inne hat. Dazu gehört neben der Einstellung der Eltern<br />
gegenüber <strong>dem</strong> Gastland auch die häusliche Unterstützung in schulischen<br />
Angelegenheiten.<br />
Für eine schulische Förderung fehlt es <strong>Kindern</strong> aus Migrationsfamilien gerade<br />
im familiären Bereich oft an Unterstützung. Wie bereits geschildert (Kap.<br />
2.2.4), ist die Hausaufgabenpraxis kritisch zu betrachten, die an deutschen<br />
Schulen vorherrscht: Bei vielen Aufgaben ist eine Mithilfe Erwachsener<br />
erforderlich <strong>und</strong> notwendig. Gerade in ausländischen Familien fehlt diese<br />
Unterstützung, sei es, weil die Eltern aus sprachlichen oder kulturellen<br />
Gründen die Aufgaben nicht verstehen, sei es, weil sie nicht erreichbar sind.<br />
Müller (1996) gibt zu bedenken, dass zwar ein Zusammenhang zwischen<br />
„integrativer Einstellung“ <strong>und</strong> „schulsprachlicher Leistung“ (ebd., S. 35)<br />
bestehen kann (<strong>und</strong> dass dies recht leicht nachzuweisen sei), dass es aber<br />
nicht gerechtfertigt ist, auf eine direkte Abhängigkeit zu schließen.<br />
Er überprüft weitere mögliche Ursachen einer schulischen Benachteiligung<br />
ausländischer Kinder, neben sprachlicher Leistungen, um zu widerlegen,<br />
dass allein diese ausschlaggebend sind. Andere Faktoren können eine viel<br />
entscheidendere Rolle spielen, wie zum Beispiel die Motivation oder die<br />
Begabung für das Erlernen einer Fremdsprache, die individuell<br />
51