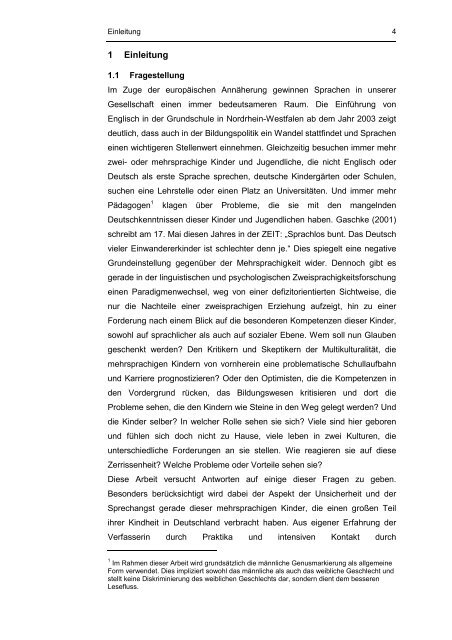Soziale Hemmung und Sprechangst bei Kindern unter dem Aspekt ...
Soziale Hemmung und Sprechangst bei Kindern unter dem Aspekt ...
Soziale Hemmung und Sprechangst bei Kindern unter dem Aspekt ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Einleitung 4<br />
1 Einleitung<br />
1.1 Fragestellung<br />
Im Zuge der europäischen Annäherung gewinnen Sprachen in unserer<br />
Gesellschaft einen immer bedeutsameren Raum. Die Einführung von<br />
Englisch in der Gr<strong>und</strong>schule in Nordrhein-Westfalen ab <strong>dem</strong> Jahr 2003 zeigt<br />
deutlich, dass auch in der Bildungspolitik ein Wandel stattfindet <strong>und</strong> Sprachen<br />
einen wichtigeren Stellenwert einnehmen. Gleichzeitig besuchen immer mehr<br />
zwei- oder mehrsprachige Kinder <strong>und</strong> Jugendliche, die nicht Englisch oder<br />
Deutsch als erste Sprache sprechen, deutsche Kindergärten oder Schulen,<br />
suchen eine Lehrstelle oder einen Platz an Universitäten. Und immer mehr<br />
Pädagogen 1 klagen über Probleme, die sie mit den mangelnden<br />
Deutschkenntnissen dieser Kinder <strong>und</strong> Jugendlichen haben. Gaschke (2001)<br />
schreibt am 17. Mai diesen Jahres in der ZEIT: „Sprachlos bunt. Das Deutsch<br />
vieler Einwandererkinder ist schlechter denn je.“ Dies spiegelt eine negative<br />
Gr<strong>und</strong>einstellung gegenüber der Mehrsprachigkeit wider. Dennoch gibt es<br />
gerade in der linguistischen <strong>und</strong> psychologischen Zweisprachigkeitsforschung<br />
einen Paradigmenwechsel, weg von einer defizitorientierten Sichtweise, die<br />
nur die Nachteile einer zweisprachigen Erziehung aufzeigt, hin zu einer<br />
Forderung nach einem Blick auf die besonderen Kompetenzen dieser Kinder,<br />
sowohl auf sprachlicher als auch auf sozialer Ebene. Wem soll nun Glauben<br />
geschenkt werden? Den Kritikern <strong>und</strong> Skeptikern der Multikulturalität, die<br />
mehrsprachigen <strong>Kindern</strong> von vornherein eine problematische Schullaufbahn<br />
<strong>und</strong> Karriere prognostizieren? Oder den Optimisten, die die Kompetenzen in<br />
den Vordergr<strong>und</strong> rücken, das Bildungswesen kritisieren <strong>und</strong> dort die<br />
Probleme sehen, die den <strong>Kindern</strong> wie Steine in den Weg gelegt werden? Und<br />
die Kinder selber? In welcher Rolle sehen sie sich? Viele sind hier geboren<br />
<strong>und</strong> fühlen sich doch nicht zu Hause, viele leben in zwei Kulturen, die<br />
<strong>unter</strong>schiedliche Forderungen an sie stellen. Wie reagieren sie auf diese<br />
Zerrissenheit? Welche Probleme oder Vorteile sehen sie?<br />
Diese Ar<strong>bei</strong>t versucht Antworten auf einige dieser Fragen zu geben.<br />
Besonders berücksichtigt wird da<strong>bei</strong> der <strong>Aspekt</strong> der Unsicherheit <strong>und</strong> der<br />
<strong>Sprechangst</strong> gerade dieser mehrsprachigen Kinder, die einen großen Teil<br />
ihrer Kindheit in Deutschland verbracht haben. Aus eigener Erfahrung der<br />
Verfasserin durch Praktika <strong>und</strong> intensiven Kontakt durch<br />
1 Im Rahmen dieser Ar<strong>bei</strong>t wird gr<strong>und</strong>sätzlich die männliche Genusmarkierung als allgemeine<br />
Form verwendet. Dies impliziert sowohl das männliche als auch das weibliche Geschlecht <strong>und</strong><br />
stellt keine Diskriminierung des weiblichen Geschlechts dar, sondern dient <strong>dem</strong> besseren<br />
Lesefluss.