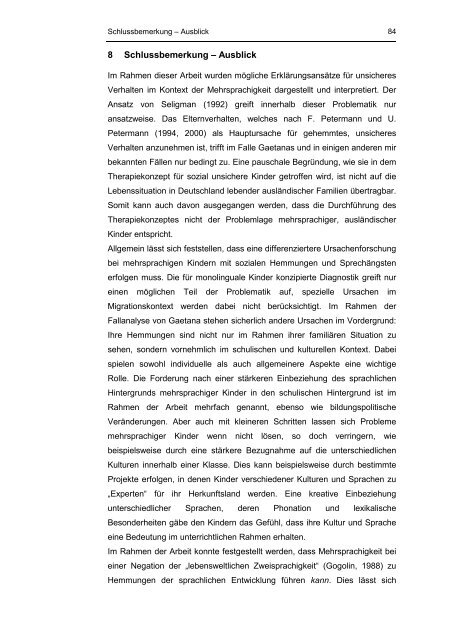Soziale Hemmung und Sprechangst bei Kindern unter dem Aspekt ...
Soziale Hemmung und Sprechangst bei Kindern unter dem Aspekt ...
Soziale Hemmung und Sprechangst bei Kindern unter dem Aspekt ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Schlussbemerkung – Ausblick<br />
8 Schlussbemerkung – Ausblick<br />
Im Rahmen dieser Ar<strong>bei</strong>t wurden mögliche Erklärungsansätze für unsicheres<br />
Verhalten im Kontext der Mehrsprachigkeit dargestellt <strong>und</strong> interpretiert. Der<br />
Ansatz von Seligman (1992) greift innerhalb dieser Problematik nur<br />
ansatzweise. Das Elternverhalten, welches nach F. Petermann <strong>und</strong> U.<br />
Petermann (1994, 2000) als Hauptursache für gehemmtes, unsicheres<br />
Verhalten anzunehmen ist, trifft im Falle Gaetanas <strong>und</strong> in einigen anderen mir<br />
bekannten Fällen nur bedingt zu. Eine pauschale Begründung, wie sie in <strong>dem</strong><br />
Therapiekonzept für sozial unsichere Kinder getroffen wird, ist nicht auf die<br />
Lebenssituation in Deutschland lebender ausländischer Familien übertragbar.<br />
Somit kann auch davon ausgegangen werden, dass die Durchführung des<br />
Therapiekonzeptes nicht der Problemlage mehrsprachiger, ausländischer<br />
Kinder entspricht.<br />
Allgemein lässt sich feststellen, dass eine differenziertere Ursachenforschung<br />
<strong>bei</strong> mehrsprachigen <strong>Kindern</strong> mit sozialen <strong>Hemmung</strong>en <strong>und</strong> Sprechängsten<br />
erfolgen muss. Die für monolinguale Kinder konzipierte Diagnostik greift nur<br />
einen möglichen Teil der Problematik auf, spezielle Ursachen im<br />
Migrationskontext werden da<strong>bei</strong> nicht berücksichtigt. Im Rahmen der<br />
Fallanalyse von Gaetana stehen sicherlich andere Ursachen im Vordergr<strong>und</strong>:<br />
Ihre <strong>Hemmung</strong>en sind nicht nur im Rahmen ihrer familiären Situation zu<br />
sehen, sondern vornehmlich im schulischen <strong>und</strong> kulturellen Kontext. Da<strong>bei</strong><br />
spielen sowohl individuelle als auch allgemeinere <strong>Aspekt</strong>e eine wichtige<br />
Rolle. Die Forderung nach einer stärkeren Einbeziehung des sprachlichen<br />
Hintergr<strong>und</strong>s mehrsprachiger Kinder in den schulischen Hintergr<strong>und</strong> ist im<br />
Rahmen der Ar<strong>bei</strong>t mehrfach genannt, ebenso wie bildungspolitische<br />
Veränderungen. Aber auch mit kleineren Schritten lassen sich Probleme<br />
mehrsprachiger Kinder wenn nicht lösen, so doch verringern, wie<br />
<strong>bei</strong>spielsweise durch eine stärkere Bezugnahme auf die <strong>unter</strong>schiedlichen<br />
Kulturen innerhalb einer Klasse. Dies kann <strong>bei</strong>spielsweise durch bestimmte<br />
Projekte erfolgen, in denen Kinder verschiedener Kulturen <strong>und</strong> Sprachen zu<br />
„Experten“ für ihr Herkunftsland werden. Eine kreative Einbeziehung<br />
<strong>unter</strong>schiedlicher Sprachen, deren Phonation <strong>und</strong> lexikalische<br />
Besonderheiten gäbe den <strong>Kindern</strong> das Gefühl, dass ihre Kultur <strong>und</strong> Sprache<br />
eine Bedeutung im <strong>unter</strong>richtlichen Rahmen erhalten.<br />
Im Rahmen der Ar<strong>bei</strong>t konnte festgestellt werden, dass Mehrsprachigkeit <strong>bei</strong><br />
einer Negation der „lebensweltlichen Zweisprachigkeit“ (Gogolin, 1988) zu<br />
<strong>Hemmung</strong>en der sprachlichen Entwicklung führen kann. Dies lässt sich<br />
84