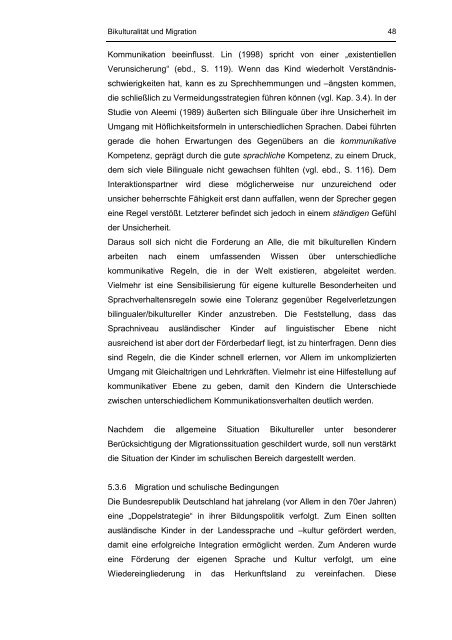Soziale Hemmung und Sprechangst bei Kindern unter dem Aspekt ...
Soziale Hemmung und Sprechangst bei Kindern unter dem Aspekt ...
Soziale Hemmung und Sprechangst bei Kindern unter dem Aspekt ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Bikulturalität <strong>und</strong> Migration<br />
Kommunikation beeinflusst. Lin (1998) spricht von einer „existentiellen<br />
Verunsicherung“ (ebd., S. 119). Wenn das Kind wiederholt Verständnisschwierigkeiten<br />
hat, kann es zu Sprechhemmungen <strong>und</strong> –ängsten kommen,<br />
die schließlich zu Vermeidungsstrategien führen können (vgl. Kap. 3.4). In der<br />
Studie von Aleemi (1989) äußerten sich Bilinguale über ihre Unsicherheit im<br />
Umgang mit Höflichkeitsformeln in <strong>unter</strong>schiedlichen Sprachen. Da<strong>bei</strong> führten<br />
gerade die hohen Erwartungen des Gegenübers an die kommunikative<br />
Kompetenz, geprägt durch die gute sprachliche Kompetenz, zu einem Druck,<br />
<strong>dem</strong> sich viele Bilinguale nicht gewachsen fühlten (vgl. ebd., S. 116). Dem<br />
Interaktionspartner wird diese möglicherweise nur unzureichend oder<br />
unsicher beherrschte Fähigkeit erst dann auffallen, wenn der Sprecher gegen<br />
eine Regel verstößt. Letzterer befindet sich jedoch in einem ständigen Gefühl<br />
der Unsicherheit.<br />
Daraus soll sich nicht die Forderung an Alle, die mit bikulturellen <strong>Kindern</strong><br />
ar<strong>bei</strong>ten nach einem umfassenden Wissen über <strong>unter</strong>schiedliche<br />
kommunikative Regeln, die in der Welt existieren, abgeleitet werden.<br />
Vielmehr ist eine Sensibilisierung für eigene kulturelle Besonderheiten <strong>und</strong><br />
Sprachverhaltensregeln sowie eine Toleranz gegenüber Regelverletzungen<br />
bilingualer/bikultureller Kinder anzustreben. Die Feststellung, dass das<br />
Sprachniveau ausländischer Kinder auf linguistischer Ebene nicht<br />
ausreichend ist aber dort der Förderbedarf liegt, ist zu hinterfragen. Denn dies<br />
sind Regeln, die die Kinder schnell erlernen, vor Allem im unkomplizierten<br />
Umgang mit Gleichaltrigen <strong>und</strong> Lehrkräften. Vielmehr ist eine Hilfestellung auf<br />
kommunikativer Ebene zu geben, damit den <strong>Kindern</strong> die Unterschiede<br />
zwischen <strong>unter</strong>schiedlichem Kommunikationsverhalten deutlich werden.<br />
Nach<strong>dem</strong> die allgemeine Situation Bikultureller <strong>unter</strong> besonderer<br />
Berücksichtigung der Migrationssituation geschildert wurde, soll nun verstärkt<br />
die Situation der Kinder im schulischen Bereich dargestellt werden.<br />
5.3.6 Migration <strong>und</strong> schulische Bedingungen<br />
Die B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland hat jahrelang (vor Allem in den 70er Jahren)<br />
eine „Doppelstrategie“ in ihrer Bildungspolitik verfolgt. Zum Einen sollten<br />
ausländische Kinder in der Landessprache <strong>und</strong> –kultur gefördert werden,<br />
damit eine erfolgreiche Integration ermöglicht werden. Zum Anderen wurde<br />
eine Förderung der eigenen Sprache <strong>und</strong> Kultur verfolgt, um eine<br />
Wiedereingliederung in das Herkunftsland zu vereinfachen. Diese<br />
48