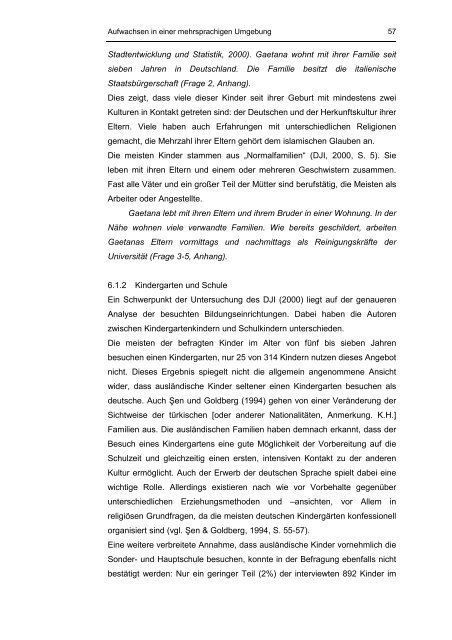Soziale Hemmung und Sprechangst bei Kindern unter dem Aspekt ...
Soziale Hemmung und Sprechangst bei Kindern unter dem Aspekt ...
Soziale Hemmung und Sprechangst bei Kindern unter dem Aspekt ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Aufwachsen in einer mehrsprachigen Umgebung<br />
Stadtentwicklung <strong>und</strong> Statistik, 2000). Gaetana wohnt mit ihrer Familie seit<br />
sieben Jahren in Deutschland. Die Familie besitzt die italienische<br />
Staatsbürgerschaft (Frage 2, Anhang).<br />
Dies zeigt, dass viele dieser Kinder seit ihrer Geburt mit mindestens zwei<br />
Kulturen in Kontakt getreten sind: der Deutschen <strong>und</strong> der Herkunftskultur ihrer<br />
Eltern. Viele haben auch Erfahrungen mit <strong>unter</strong>schiedlichen Religionen<br />
gemacht, die Mehrzahl ihrer Eltern gehört <strong>dem</strong> islamischen Glauben an.<br />
Die meisten Kinder stammen aus „Normalfamilien“ (DJI, 2000, S. 5). Sie<br />
leben mit ihren Eltern <strong>und</strong> einem oder mehreren Geschwistern zusammen.<br />
Fast alle Väter <strong>und</strong> ein großer Teil der Mütter sind berufstätig, die Meisten als<br />
Ar<strong>bei</strong>ter oder Angestellte.<br />
Gaetana lebt mit ihren Eltern <strong>und</strong> ihrem Bruder in einer Wohnung. In der<br />
Nähe wohnen viele verwandte Familien. Wie bereits geschildert, ar<strong>bei</strong>ten<br />
Gaetanas Eltern vormittags <strong>und</strong> nachmittags als Reinigungskräfte der<br />
Universität (Frage 3-5, Anhang).<br />
6.1.2 Kindergarten <strong>und</strong> Schule<br />
Ein Schwerpunkt der Untersuchung des DJI (2000) liegt auf der genaueren<br />
Analyse der besuchten Bildungseinrichtungen. Da<strong>bei</strong> haben die Autoren<br />
zwischen Kindergartenkindern <strong>und</strong> Schulkindern <strong>unter</strong>schieden.<br />
Die meisten der befragten Kinder im Alter von fünf bis sieben Jahren<br />
besuchen einen Kindergarten, nur 25 von 314 <strong>Kindern</strong> nutzen dieses Angebot<br />
nicht. Dieses Ergebnis spiegelt nicht die allgemein angenommene Ansicht<br />
wider, dass ausländische Kinder seltener einen Kindergarten besuchen als<br />
deutsche. Auch Şen <strong>und</strong> Goldberg (1994) gehen von einer Veränderung der<br />
Sichtweise der türkischen [oder anderer Nationalitäten, Anmerkung. K.H.]<br />
Familien aus. Die ausländischen Familien haben <strong>dem</strong>nach erkannt, dass der<br />
Besuch eines Kindergartens eine gute Möglichkeit der Vorbereitung auf die<br />
Schulzeit <strong>und</strong> gleichzeitig einen ersten, intensiven Kontakt zu der anderen<br />
Kultur ermöglicht. Auch der Erwerb der deutschen Sprache spielt da<strong>bei</strong> eine<br />
wichtige Rolle. Allerdings existieren nach wie vor Vorbehalte gegenüber<br />
<strong>unter</strong>schiedlichen Erziehungsmethoden <strong>und</strong> –ansichten, vor Allem in<br />
religiösen Gr<strong>und</strong>fragen, da die meisten deutschen Kindergärten konfessionell<br />
organisiert sind (vgl. Şen & Goldberg, 1994, S. 55-57).<br />
Eine weitere verbreitete Annahme, dass ausländische Kinder vornehmlich die<br />
Sonder- <strong>und</strong> Hauptschule besuchen, konnte in der Befragung ebenfalls nicht<br />
bestätigt werden: Nur ein geringer Teil (2%) der interviewten 892 Kinder im<br />
57