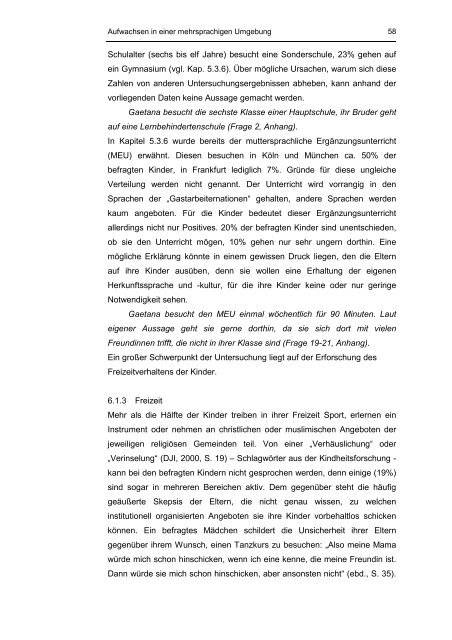Soziale Hemmung und Sprechangst bei Kindern unter dem Aspekt ...
Soziale Hemmung und Sprechangst bei Kindern unter dem Aspekt ...
Soziale Hemmung und Sprechangst bei Kindern unter dem Aspekt ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Aufwachsen in einer mehrsprachigen Umgebung<br />
Schulalter (sechs bis elf Jahre) besucht eine Sonderschule, 23% gehen auf<br />
ein Gymnasium (vgl. Kap. 5.3.6). Über mögliche Ursachen, warum sich diese<br />
Zahlen von anderen Untersuchungsergebnissen abheben, kann anhand der<br />
vorliegenden Daten keine Aussage gemacht werden.<br />
Gaetana besucht die sechste Klasse einer Hauptschule, ihr Bruder geht<br />
auf eine Lernbehindertenschule (Frage 2, Anhang).<br />
In Kapitel 5.3.6 wurde bereits der muttersprachliche Ergänzungs<strong>unter</strong>richt<br />
(MEU) erwähnt. Diesen besuchen in Köln <strong>und</strong> München ca. 50% der<br />
befragten Kinder, in Frankfurt lediglich 7%. Gründe für diese ungleiche<br />
Verteilung werden nicht genannt. Der Unterricht wird vorrangig in den<br />
Sprachen der „Gastar<strong>bei</strong>ternationen“ gehalten, andere Sprachen werden<br />
kaum angeboten. Für die Kinder bedeutet dieser Ergänzungs<strong>unter</strong>richt<br />
allerdings nicht nur Positives. 20% der befragten Kinder sind unentschieden,<br />
ob sie den Unterricht mögen, 10% gehen nur sehr ungern dorthin. Eine<br />
mögliche Erklärung könnte in einem gewissen Druck liegen, den die Eltern<br />
auf ihre Kinder ausüben, denn sie wollen eine Erhaltung der eigenen<br />
Herkunftssprache <strong>und</strong> -kultur, für die ihre Kinder keine oder nur geringe<br />
Notwendigkeit sehen.<br />
Gaetana besucht den MEU einmal wöchentlich für 90 Minuten. Laut<br />
eigener Aussage geht sie gerne dorthin, da sie sich dort mit vielen<br />
Fre<strong>und</strong>innen trifft, die nicht in ihrer Klasse sind (Frage 19-21, Anhang).<br />
Ein großer Schwerpunkt der Untersuchung liegt auf der Erforschung des<br />
Freizeitverhaltens der Kinder.<br />
6.1.3 Freizeit<br />
Mehr als die Hälfte der Kinder treiben in ihrer Freizeit Sport, erlernen ein<br />
Instrument oder nehmen an christlichen oder muslimischen Angeboten der<br />
jeweiligen religiösen Gemeinden teil. Von einer „Verhäuslichung“ oder<br />
„Verinselung“ (DJI, 2000, S. 19) – Schlagwörter aus der Kindheitsforschung -<br />
kann <strong>bei</strong> den befragten <strong>Kindern</strong> nicht gesprochen werden, denn einige (19%)<br />
sind sogar in mehreren Bereichen aktiv. Dem gegenüber steht die häufig<br />
geäußerte Skepsis der Eltern, die nicht genau wissen, zu welchen<br />
institutionell organisierten Angeboten sie ihre Kinder vorbehaltlos schicken<br />
können. Ein befragtes Mädchen schildert die Unsicherheit ihrer Eltern<br />
gegenüber ihrem Wunsch, einen Tanzkurs zu besuchen: „Also meine Mama<br />
würde mich schon hinschicken, wenn ich eine kenne, die meine Fre<strong>und</strong>in ist.<br />
Dann würde sie mich schon hinschicken, aber ansonsten nicht“ (ebd., S. 35).<br />
58