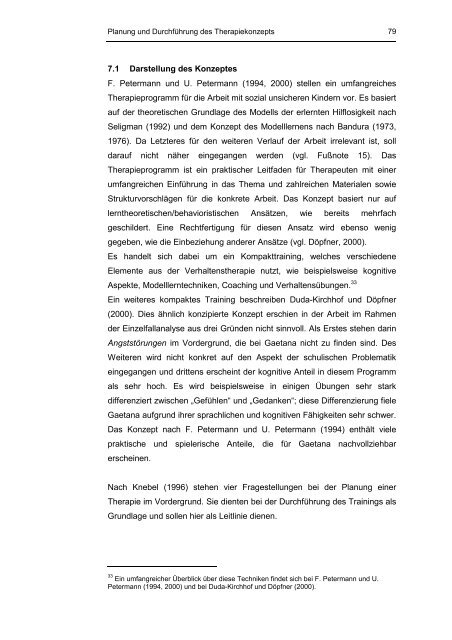Soziale Hemmung und Sprechangst bei Kindern unter dem Aspekt ...
Soziale Hemmung und Sprechangst bei Kindern unter dem Aspekt ...
Soziale Hemmung und Sprechangst bei Kindern unter dem Aspekt ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Planung <strong>und</strong> Durchführung des Therapiekonzepts<br />
7.1 Darstellung des Konzeptes<br />
F. Petermann <strong>und</strong> U. Petermann (1994, 2000) stellen ein umfangreiches<br />
Therapieprogramm für die Ar<strong>bei</strong>t mit sozial unsicheren <strong>Kindern</strong> vor. Es basiert<br />
auf der theoretischen Gr<strong>und</strong>lage des Modells der erlernten Hilflosigkeit nach<br />
Seligman (1992) <strong>und</strong> <strong>dem</strong> Konzept des Modelllernens nach Bandura (1973,<br />
1976). Da Letzteres für den weiteren Verlauf der Ar<strong>bei</strong>t irrelevant ist, soll<br />
darauf nicht näher eingegangen werden (vgl. Fußnote 15). Das<br />
Therapieprogramm ist ein praktischer Leitfaden für Therapeuten mit einer<br />
umfangreichen Einführung in das Thema <strong>und</strong> zahlreichen Materialen sowie<br />
Strukturvorschlägen für die konkrete Ar<strong>bei</strong>t. Das Konzept basiert nur auf<br />
lerntheoretischen/behavioristischen Ansätzen, wie bereits mehrfach<br />
geschildert. Eine Rechtfertigung für diesen Ansatz wird ebenso wenig<br />
gegeben, wie die Einbeziehung anderer Ansätze (vgl. Döpfner, 2000).<br />
Es handelt sich da<strong>bei</strong> um ein Kompakttraining, welches verschiedene<br />
Elemente aus der Verhaltenstherapie nutzt, wie <strong>bei</strong>spielsweise kognitive<br />
<strong>Aspekt</strong>e, Modelllerntechniken, Coaching <strong>und</strong> Verhaltensübungen. 33<br />
Ein weiteres kompaktes Training beschreiben Duda-Kirchhof <strong>und</strong> Döpfner<br />
(2000). Dies ähnlich konzipierte Konzept erschien in der Ar<strong>bei</strong>t im Rahmen<br />
der Einzelfallanalyse aus drei Gründen nicht sinnvoll. Als Erstes stehen darin<br />
Angststörungen im Vordergr<strong>und</strong>, die <strong>bei</strong> Gaetana nicht zu finden sind. Des<br />
Weiteren wird nicht konkret auf den <strong>Aspekt</strong> der schulischen Problematik<br />
eingegangen <strong>und</strong> drittens erscheint der kognitive Anteil in diesem Programm<br />
als sehr hoch. Es wird <strong>bei</strong>spielsweise in einigen Übungen sehr stark<br />
differenziert zwischen „Gefühlen“ <strong>und</strong> „Gedanken“; diese Differenzierung fiele<br />
Gaetana aufgr<strong>und</strong> ihrer sprachlichen <strong>und</strong> kognitiven Fähigkeiten sehr schwer.<br />
Das Konzept nach F. Petermann <strong>und</strong> U. Petermann (1994) enthält viele<br />
praktische <strong>und</strong> spielerische Anteile, die für Gaetana nachvollziehbar<br />
erscheinen.<br />
Nach Knebel (1996) stehen vier Fragestellungen <strong>bei</strong> der Planung einer<br />
Therapie im Vordergr<strong>und</strong>. Sie dienten <strong>bei</strong> der Durchführung des Trainings als<br />
Gr<strong>und</strong>lage <strong>und</strong> sollen hier als Leitlinie dienen.<br />
33 Ein umfangreicher Überblick über diese Techniken findet sich <strong>bei</strong> F. Petermann <strong>und</strong> U.<br />
Petermann (1994, 2000) <strong>und</strong> <strong>bei</strong> Duda-Kirchhof <strong>und</strong> Döpfner (2000).<br />
79