Wärmelehre - gilligan-online
Wärmelehre - gilligan-online
Wärmelehre - gilligan-online
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Wärmelehre</strong><br />
In der Mechanik wird bei der Beschreibung physikalischer Vorgänge von Prozessen<br />
abgesehen, in denen die Energieform Wärme auftritt. Wärme wird als eine nichtmechanische<br />
Energieform verstanden.<br />
Der Satz von der Erhaltung der Energie in der Fassung der Mechanik schloss einschränkend<br />
die Umwandlung mechanischer Energieformen in nichtmechanische<br />
Energieformen, also z. B. bei Reibungsvorgängen in Wärme, aus. Die Besonderheiten<br />
physikalischer Erscheinungen, die mit den Begriffen Wärme und Innere Energie<br />
verknüpft sind, führen zu einem der Hauptgebiete der Physik, das unter der Überschrift<br />
<strong>Wärmelehre</strong> oder Thermodynamik zusammengefasst wird.<br />
1 Aufbau der Materie<br />
Die Bausteine der Materie sind Atome, Moleküle oder Ionen und Elektronen, die man<br />
vereinfachend und zusammenfassend Teilchen nennt. Diese Teilchen sind niemals<br />
in Ruhe: Sie führen ständig statistisch ungeordnete Bewegungen aus. Temperatur ist<br />
ein Maß für die Heftigkeit dieser thermischen Bewegung. Der Energieinhalt eines<br />
Stoffes auf Grund dieser Bewegungen und der Wechselwirkungen zwischen den<br />
Teilchen wird als Innere Energie bezeichnet. Der Begriff Wärme wird für eine Energieform<br />
verwendet, die einem Körper bzw. System zugeführt oder von ihm abgegeben<br />
wird.<br />
Die internationale (und in der Bundesrepublik gesetzliche) Einheit der Wärme Q ist<br />
die Einheit aller Energiearten<br />
Q = 1Joule = 1J = 1Nm = 1 V A s 1 W<br />
[ ] s<br />
int =<br />
Der makroskopische Zustand der Materie lässt sich durch die unterschiedliche Verschiebbarkeit<br />
der Bausteine gegeneinander definieren. Dies erklärt sich durch die<br />
Anordnung der Bausteine und der Art ihrer Wechselwirkung.<br />
1.1 Phasen<br />
Einfache Materie tritt makroskopisch in drei verschiedenen Erscheinungsformen auf:<br />
Fest, flüssig und gasförmig. Diese Erscheinungsformen heißen Aggregatzustände<br />
oder allgemein Phasen. (Als vierten Aggregatzustand bezeichnet man den Plasmazustand.<br />
Ein Plasma ist ein Gemisch aus freien Elektronen, positiven Ionen und<br />
Neutralteilchen eines Gases.)<br />
Der feste Zustand kann in amorpher oder kristalliner Form auftreten. In einem Kristallgitter<br />
sind die Teilchen an eine Gleichgewichtslage gebunden. Die Teilchen bleiben<br />
ihrem (mathematischen) Gitterpunkt zugeordnet, führen aber um ihre Gleichgewichtslage<br />
ungeordnete Schwingungen aus. Veranschaulicht werden die Kräfte zwischen<br />
einem Teilchen und seinen Nachbarteilchen durch Federn. Die Bewegungen<br />
der Gitterbausteine nennt man Gitterschwingungen (Phononen).<br />
Die Gitterstruktur drückt das Ordnungsprinzip des festen, kristallinen Zustandes aus.<br />
Beispiele bringt Abb. 1-01.<br />
Feste Körper sind formbeständig und haben eine Oberfläche. Die Dichten ρ fester<br />
Stoffe liegen i. Allg. im Bereich ρ ≈ 10 K10<br />
kg m .<br />
3<br />
4<br />
−3<br />
<strong>Wärmelehre</strong> – Abschnitt 1<br />
- 5 -<br />
’Aufbau der Materie’












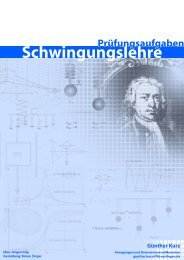

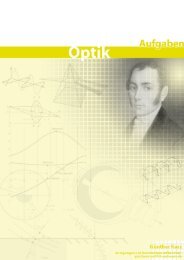
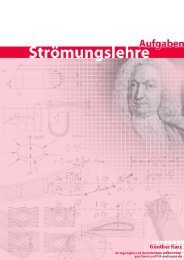
![[1.5pt] Wellenlehre[8.5pt] Zusammenfassung - gilligan-online](https://img.yumpu.com/21507627/1/184x260/15pt-wellenlehre85pt-zusammenfassung-gilligan-online.jpg?quality=85)