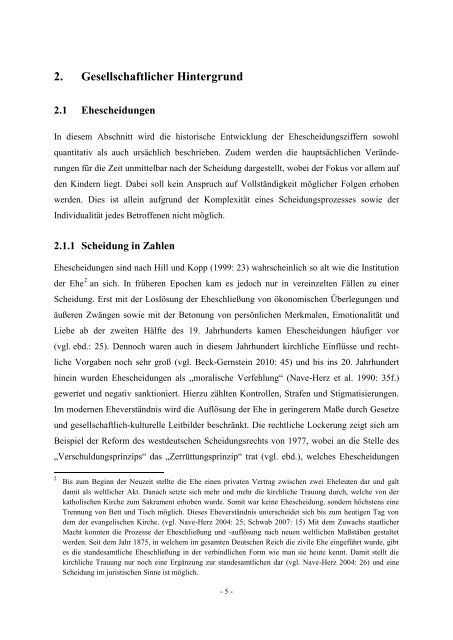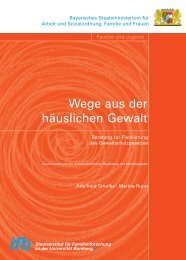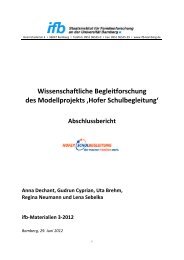Diplomarbeit Der Einfluss der elterlichen Scheidung auf das ... - ifb
Diplomarbeit Der Einfluss der elterlichen Scheidung auf das ... - ifb
Diplomarbeit Der Einfluss der elterlichen Scheidung auf das ... - ifb
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
2. Gesellschaftlicher Hintergrund<br />
2.1 Ehescheidungen<br />
In diesem Abschnitt wird die historische Entwicklung <strong>der</strong> Ehescheidungsziffern sowohl<br />
quantitativ als auch ursächlich beschrieben. Zudem werden die hauptsächlichen Verän<strong>der</strong>ungen<br />
für die Zeit unmittelbar nach <strong>der</strong> <strong>Scheidung</strong> dargestellt, wobei <strong>der</strong> Fokus vor allem <strong>auf</strong><br />
den Kin<strong>der</strong>n liegt. Dabei soll kein Anspruch <strong>auf</strong> Vollständigkeit möglicher Folgen erhoben<br />
werden. Dies ist allein <strong>auf</strong>grund <strong>der</strong> Komplexität eines <strong>Scheidung</strong>sprozesses sowie <strong>der</strong><br />
Individualität jedes Betroffenen nicht möglich.<br />
2.1.1 <strong>Scheidung</strong> in Zahlen<br />
Ehescheidungen sind nach Hill und Kopp (1999: 23) wahrscheinlich so alt wie die Institution<br />
<strong>der</strong> Ehe 2 an sich. In früheren Epochen kam es jedoch nur in vereinzelten Fällen zu einer<br />
<strong>Scheidung</strong>. Erst mit <strong>der</strong> Loslösung <strong>der</strong> Eheschließung von ökonomischen Überlegungen und<br />
äußeren Zwängen sowie mit <strong>der</strong> Betonung von persönlichen Merkmalen, Emotionalität und<br />
Liebe ab <strong>der</strong> zweiten Hälfte des 19. Jahrhun<strong>der</strong>ts kamen Ehescheidungen häufiger vor<br />
(vgl. ebd.: 25). Dennoch waren auch in diesem Jahrhun<strong>der</strong>t kirchliche Einflüsse und rechtliche<br />
Vorgaben noch sehr groß (vgl. Beck-Gernstein 2010: 45) und bis ins 20. Jahrhun<strong>der</strong>t<br />
hinein wurden Ehescheidungen als „moralische Verfehlung“ (Nave-Herz et al. 1990: 35f.)<br />
gewertet und negativ sanktioniert. Hierzu zählten Kontrollen, Strafen und Stigmatisierungen.<br />
Im mo<strong>der</strong>nen Eheverständnis wird die Auflösung <strong>der</strong> Ehe in geringerem Maße durch Gesetze<br />
und gesellschaftlich-kulturelle Leitbil<strong>der</strong> beschränkt. Die rechtliche Lockerung zeigt sich am<br />
Beispiel <strong>der</strong> Reform des westdeutschen <strong>Scheidung</strong>srechts von 1977, wobei an die Stelle des<br />
„Verschuldungsprinzips“ <strong>das</strong> „Zerrüttungsprinzip“ trat (vgl. ebd.), welches Ehescheidungen<br />
2<br />
Bis zum Beginn <strong>der</strong> Neuzeit stellte die Ehe einen privaten Vertrag zwischen zwei Eheleuten dar und galt<br />
damit als weltlicher Akt. Danach setzte sich mehr und mehr die kirchliche Trauung durch, welche von <strong>der</strong><br />
katholischen Kirche zum Sakrament erhoben wurde. Somit war keine Ehescheidung, son<strong>der</strong>n höchstens eine<br />
Trennung von Bett und Tisch möglich. Dieses Eheverständnis unterscheidet sich bis zum heutigen Tag von<br />
dem <strong>der</strong> evangelischen Kirche. (vgl. Nave-Herz 2004: 25; Schwab 2007: 15) Mit dem Zuwachs staatlicher<br />
Macht konnten die Prozesse <strong>der</strong> Eheschließung und -<strong>auf</strong>lösung nach neuen weltlichen Maßstäben gestaltet<br />
werden. Seit dem Jahr 1875, in welchem im gesamten Deutschen Reich die zivile Ehe eingeführt wurde, gibt<br />
es die standesamtliche Eheschließung in <strong>der</strong> verbindlichen Form wie man sie heute kennt. Damit stellt die<br />
kirchliche Trauung nur noch eine Ergänzung zur standesamtlichen dar (vgl. Nave-Herz 2004: 26) und eine<br />
<strong>Scheidung</strong> im juristischen Sinne ist möglich.<br />
- 5 -