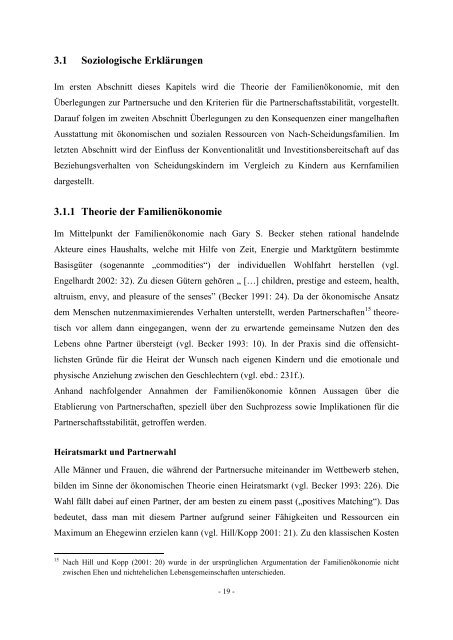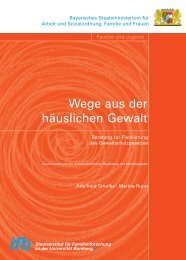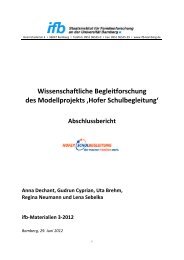Diplomarbeit Der Einfluss der elterlichen Scheidung auf das ... - ifb
Diplomarbeit Der Einfluss der elterlichen Scheidung auf das ... - ifb
Diplomarbeit Der Einfluss der elterlichen Scheidung auf das ... - ifb
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
3.1 Soziologische Erklärungen<br />
Im ersten Abschnitt dieses Kapitels wird die Theorie <strong>der</strong> Familienökonomie, mit den<br />
Überlegungen zur Partnersuche und den Kriterien für die Partnerschaftsstabilität, vorgestellt.<br />
Dar<strong>auf</strong> folgen im zweiten Abschnitt Überlegungen zu den Konsequenzen einer mangelhaften<br />
Ausstattung mit ökonomischen und sozialen Ressourcen von Nach-<strong>Scheidung</strong>sfamilien. Im<br />
letzten Abschnitt wird <strong>der</strong> <strong>Einfluss</strong> <strong>der</strong> Konventionalität und Investitionsbereitschaft <strong>auf</strong> <strong>das</strong><br />
Beziehungsverhalten von <strong>Scheidung</strong>skin<strong>der</strong>n im Vergleich zu Kin<strong>der</strong>n aus Kernfamilien<br />
dargestellt.<br />
3.1.1 Theorie <strong>der</strong> Familienökonomie<br />
Im Mittelpunkt <strong>der</strong> Familienökonomie nach Gary S. Becker stehen rational handelnde<br />
Akteure eines Haushalts, welche mit Hilfe von Zeit, Energie und Marktgütern bestimmte<br />
Basisgüter (sogenannte „commodities“) <strong>der</strong> individuellen Wohlfahrt herstellen (vgl.<br />
Engelhardt 2002: 32). Zu diesen Gütern gehören „ […] children, prestige and esteem, health,<br />
altruism, envy, and pleasure of the senses” (Becker 1991: 24). Da <strong>der</strong> ökonomische Ansatz<br />
dem Menschen nutzenmaximierendes Verhalten unterstellt, werden Partnerschaften 15 theoretisch<br />
vor allem dann eingegangen, wenn <strong>der</strong> zu erwartende gemeinsame Nutzen den des<br />
Lebens ohne Partner übersteigt (vgl. Becker 1993: 10). In <strong>der</strong> Praxis sind die offensichtlichsten<br />
Gründe für die Heirat <strong>der</strong> Wunsch nach eigenen Kin<strong>der</strong>n und die emotionale und<br />
physische Anziehung zwischen den Geschlechtern (vgl. ebd.: 231f.).<br />
Anhand nachfolgen<strong>der</strong> Annahmen <strong>der</strong> Familienökonomie können Aussagen über die<br />
Etablierung von Partnerschaften, speziell über den Suchprozess sowie Implikationen für die<br />
Partnerschaftsstabilität, getroffen werden.<br />
Heiratsmarkt und Partnerwahl<br />
Alle Männer und Frauen, die während <strong>der</strong> Partnersuche miteinan<strong>der</strong> im Wettbewerb stehen,<br />
bilden im Sinne <strong>der</strong> ökonomischen Theorie einen Heiratsmarkt (vgl. Becker 1993: 226). Die<br />
Wahl fällt dabei <strong>auf</strong> einen Partner, <strong>der</strong> am besten zu einem passt („positives Matching“). Das<br />
bedeutet, <strong>das</strong>s man mit diesem Partner <strong>auf</strong>grund seiner Fähigkeiten und Ressourcen ein<br />
Maximum an Ehegewinn erzielen kann (vgl. Hill/Kopp 2001: 21). Zu den klassischen Kosten<br />
15 Nach Hill und Kopp (2001: 20) wurde in <strong>der</strong> ursprünglichen Argumentation <strong>der</strong> Familienökonomie nicht<br />
zwischen Ehen und nichtehelichen Lebensgemeinschaften unterschieden.<br />
- 19 -