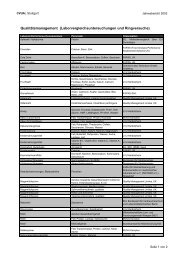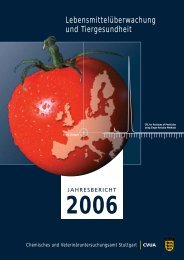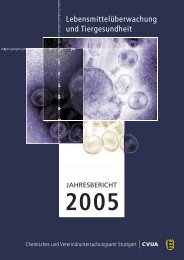CVUAS JB 2003 Gesamtdokument
CVUAS JB 2003 Gesamtdokument
CVUAS JB 2003 Gesamtdokument
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Jahresbericht <strong>2003</strong><br />
2. Rindergesundheitsdienst<br />
Personal: Dres. Mandl, Seemann, Seeh (RGD / PGD)<br />
Bei insgesamt 603 Betriebsbesuchen im Berichtsjahr wa-<br />
ren Fruchtbarkeitsstörungen bei Milchkühen der häufigste<br />
Grund, den Rindergesundheitsdienst hinzu zu ziehen.<br />
Probleme mit der Brunsterkennung infolge undeutlicher<br />
bzw. stiller Brunst, vermehrtes Umrindern und unsaubere<br />
Vaginalausflüsse wurden häufig als Symptome genannt.<br />
Die extrem heiße Witterung während der Frühjahrs- und<br />
Sommermonate hatte gebietsweise deutlich geringere<br />
Futter mittelerträge und -qualitäten zur Folge, was v. a. im<br />
letzten Jahresdrittel zu negativen Auswirkungen auf das<br />
Reproduktionsgeschehen führte.<br />
Neben unsauberen Vaginalausflüssen und vermehrtem Um-<br />
rindern können auch Aborte durch Infektionen verursacht<br />
werden. Sero-positive Untersuchungsergebnisse bei Blut-<br />
proben von Aborttieren ließen Infektionen mit Chlamydien,<br />
Coxiella burnetii, Neospora caninum und dem MD-BVD-<br />
Virus als wahrscheinlichste Abortursache ermitteln. Chla-<br />
mydien- und Coxiellen-Antigen konnte z.T. in abortierten<br />
Feten, Nachgeburtsteilen und Vaginaltupfern nachgewie-<br />
sen werden.<br />
In einigen Fällen waren sowohl Infektionen, Fütterungs-<br />
und Haltungsmängel als Ursache von Gesundheitsstörun-<br />
gen festzustellen.<br />
Aufstockung der Tierzahl ohne entsprechende Erweite-<br />
rung der Stallkapazität führt zu Überbelegung, unzurei-<br />
chender Hygiene, mangelhaftem Kuhkomfort und Stress<br />
für die Tiere.<br />
Kommen noch Fütterungsfehler hinzu, treten gravierende<br />
Störungen bis hin zu vermehrten Abgängen von Tieren<br />
häufig auf.<br />
Stoffwechselstörungen, Festliegen, Labmagenverlagerun-<br />
gen sowie Klauen- und Gelenkerkrankungen waren in<br />
Betrie ben wie o. a. aufgetreten.<br />
Zur leistungsgerechten Versorgung der Tiere mit Energie,<br />
Eiweiß und Rohfaser in den jeweiligen Laktationsabschnit-<br />
ten transit-, frisch-, altmelkend und trockenstehend gehört<br />
auch ein bedarfsdeckendes Angebot an Mineralstoffen und<br />
Spurenelementen. Imbalancen bei Calcium und Phosphor<br />
waren bei Kotwasseruntersuchungen zu messen.<br />
Die Versorgung der Tiere mit dem Spurenelement Selen ist,<br />
seit selenreiche Mineralfuttermischungen im Handel sind,<br />
deutlich besser geworden, so dass ausgesprochene Man-<br />
gelsituationen nur vereinzelt – z.T. in Mutterkuhherden –<br />
zu ermitteln waren.<br />
CVUA Stuttgart<br />
123<br />
Die Bekämpfung der Rinder-Salmonellose in betroffenen<br />
Betrieben mittels Impfung wurde auch in diesem Jahr in<br />
Absprache mit den zuständigen Veterinärämtern empfoh-<br />
len. Bislang vorliegende Untersuchungsergebnisse lassen<br />
darin eine Möglichkeit erkennen, die Ausbreitung der In-<br />
fektion im Bestand zu unterbinden und die Anzahl der zu<br />
tötenden Tiere zu reduzieren.<br />
Bei Sal. typhimurium und Sal. dublin stehen zur Impfung<br />
einsetzbare Tot- und Lebendvakzinen zur Verfügung, wo-<br />
bei die orale Applikation der Lebendimpfstoffe von Kälbern<br />
offensichtlich gut, die subcutane Impfung mit Totimpfstoff<br />
hingegen weniger gut vertragen wird und bei Milchkühen<br />
meist mit Rückgang der Milchleistung einher geht.<br />
Die Anwendung stallspez. Salmonella-Vakzinen bei an-<br />
deren Stämmen als o. a. und wie in Veröffentlichungen<br />
beschrieben, erfolgte in hiesigen Rinderbeständen bisher<br />
nicht.<br />
Erreichte Sanierungserfolge bei Paratuberkulose in vom<br />
RGD betreuten Betrieben lassen sich nur bedingt bewer-<br />
ten. Zwar nimmt die Anzahl von Erkrankungen und Aus-<br />
fällen i. d. R. ab; ob eine erfolgreiche Sanierung gelungen<br />
ist, kann erst dann beurteilt werden, wenn während der<br />
folgenden Jahre bei der Nachzucht keine Klinik auftritt und<br />
serologische Reagenten nicht ermittelt werden.<br />
Kälber und Jungtiererkrankungen erstrecken sich haupt-<br />
sächlich auf Durchfälle bei den Neugeborenen und Atem-<br />
wegserkrankungen.<br />
Neben o. a. Infektionen, die auch zur Geburt lebensschwa-<br />
cher, krankheitsauffälliger Kälber führen können, waren<br />
unverändert Infektionen mit Rota- und Corona-Viren,<br />
bestimmten E. coli-Keimen und Kryptosporidien häufig<br />
Durchfallursache.<br />
Bei Atemwegserkrankungen wurden Infektionen mit dem<br />
Bovinen Respirat. Synzytial-Virus (BRSV) und Pasteurel-<br />
la- / Mannheimia-Stämmen ursächlich nachgewiesen.<br />
Atemwegserkrankungen treten bei in Iglu gehaltenen neu-<br />
geborenen Kälbern seltener auf als bei Tieren, die nicht in<br />
ständig frischer Luft und viel Licht gehalten werden.<br />
Eine deutliche Zunahme von Erkrankungen der Atemwege<br />
tritt aber immer wieder in der Gruppenhaltung mit Tränke-<br />
automat auf. Durch das i. d. R. kontinuierliche Hinzutreten<br />
neuer Kälber und die gemeinsame Benutzung des Saugers<br />
wird der Infektionskreislauf aufrecht erhalten. Chronische<br />
Erkrankungen – z.T. mehrerer Kälber in der Gruppe – konn-<br />
ten verschiedentlich diagnostiziert werden.<br />
Intensive Tierbeobachtung und Gesundheitsüberwachung<br />
der Kälber bevor sie in die Gruppe eingestellt werden, sind<br />
unbedingt notwendig.