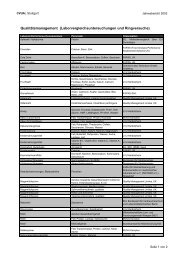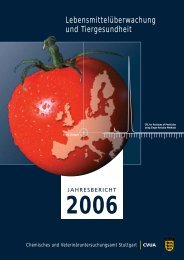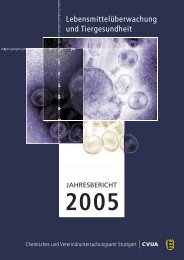CVUAS JB 2003 Gesamtdokument
CVUAS JB 2003 Gesamtdokument
CVUAS JB 2003 Gesamtdokument
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
64 CVUA Stuttgart Jahresbericht <strong>2003</strong><br />
Belegte Brötchen im Test<br />
Mit Fleisch- und Wurstwaren fertig belegte Brötchen sind<br />
beim Verbraucher sehr beliebt. Das CVUA Stuttgart hat<br />
deshalb Untersuchungen zum Hygienestatus dieser Pro-<br />
dukte sowie zur Verbraucherinformation bezüglich der In-<br />
haltsstoffe durchgeführt. Hierzu wurden im Zeitraum Au-<br />
gust bis Oktober <strong>2003</strong> insgesamt 27 belegte Brötchen in<br />
Stuttgart und Umgebung als Proben erhoben. Besonderes<br />
Augenmerk der Untersuchung wurde dabei auf die Bröt-<br />
chenbeläge gelegt.<br />
Bei der sensorischen Untersuchung der Fleischauflage,<br />
die Aussehen, Konsistenz, Farbe, Geruch und Geschmack<br />
umfasste, fiel keines der 27 Brötchen unangenehm auf.<br />
Jedoch wurden 17 (67 %) belegte Brötchen bei zu ho-<br />
hen Temperaturen (deutlich über 7 °C) gelagert, wodurch<br />
das Wachstum von Verderbniskeimen wie z. B. Milchsäure-<br />
bildner oder Pseudomonaden und Hefen gefördert wurde.<br />
Krankheitserregende Keime wurden jedoch in keiner der<br />
Proben festgestellt.<br />
Die Brötchenbeläge wurden bei Fleischkäse-Brötchen in 6<br />
von 7 Fällen und in 9 von 15 mit Kochschinken belegten<br />
Brötchen wegen zu hohen Keimgehalten beanstandet. Von<br />
den mit Brühwurst (z. B. Schinkenwurst) belegten Brötchen<br />
wiesen zwei von drei ein erhöhtes Keimwachstum auf. Die<br />
Salamibrötchen (Rohwurst) waren unauffällig (s. Abb.):<br />
Probenzahl<br />
16<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
Belegte untersucht Brötchen<br />
beanstandet<br />
Rohwurst Brühwurst Fleischkäse Schinken<br />
Die Untersuchungsergebnisse zeigten, dass bei einem<br />
Großteil (hier: 67 %) der untersuchten belegt angebote-<br />
nen Brötchen die notwendigen Hygienebedingungen nicht<br />
beachtet werden und die Waren aus diesem Grunde Ein-<br />
bußen in der Frische aufweisen. Hauptkritikpunkt ist der<br />
Umstand, dass die mit kühlungsbedürftigen Wurst- und<br />
Fleischwaren belegten Brötchen sehr oft ungekühlt gela-<br />
gert werden. Dies führt in vielen Fällen zu Keimbelastun-<br />
gen, wie sie bei z. B. Fleischkäse- und Kochschinkenproduk-<br />
ten, die von Haus aus keimfrei oder keimarm sind, nicht<br />
vorkommen dürften.<br />
2. Molekularbiologische Untersuchungen<br />
Neben den „klassischen“ mikrobiologischen und chemi-<br />
schen Untersuchungen kommt in der Lebensmittelanalytik<br />
den molekularbiologischen Methoden immer mehr Bedeu-<br />
tung zu. In der Regel wird hierbei nach der Extraktion von<br />
Erbmaterial (DNA) aus dem Lebensmittel oder aus mikrobi-<br />
ologischen Kulturen ein spezifisches Genfragment mittels<br />
Polymerasekettenreaktion (PCR) nachgewiesen. Besonders<br />
von Vorteil ist neben der hohen Sensitivität dieser Metho-<br />
den auch der relativ geringe Zeitaufwand, der für eine Un-<br />
tersuchung benötigt wird.<br />
Untersuchungen mikrobiologischer Proben<br />
Das CVUA Stuttgart ist in Baden-Württemberg Zentralla-<br />
bor für die mikrobiologische Untersuchung von Lebens-<br />
mitteln, die im Zusammenhang mit Erkrankungen stehen.<br />
Daher lag im Jahr <strong>2003</strong> auch im Bereich der molekular-<br />
biologischen Methoden besonderes Augenmerk auf dem<br />
Nachweis von pathogenen Keimen (1141 von 1288 unter-<br />
suchten Proben).<br />
265 Untersuchungen entfielen hierbei auf die schon im<br />
Vorjahr eingeführten Nachweise von Salmonellen und en-<br />
terohämorrhagischen Escherichia coli (STEC, EHEC).<br />
Zur Erweiterung des Untersuchungsspektrums wurden zu-<br />
dem PCR-Methoden zur schnellen und sicheren Unterschei-<br />
dung von pathogenen und apathogenen Keimen etabliert<br />
(Listeria spp., Clostridium perfringens; siehe hierzu auch Teil<br />
C Kapitel 1: Mikrobiologische Untersuchungen).<br />
Für Keime, die mittels kultureller Verfahren bisher nur<br />
schwer oder gar nicht nachweisbar sind, konnten For-<br />
schungsprojekte initiiert werden:<br />
Campylobacter und Yersinien<br />
Campylobacter (C. jejuni und C. coli) und Yersinien (Y. en-<br />
terocolitica) gelten als zweit- bzw. dritthäufigste Erreger<br />
bakterieller Magen-Darm-Infekte. Hauptinfektionsquellen<br />
sind gemäß Literatur Rohmilch, rohes Geflügelfleisch (Cam-<br />
pylobacter) und rohes Schweinefleisch (Y. enterocolitica).<br />
Beide Keime sind kulturell nur schwer nachweisbar. Daher<br />
sollen in einer Projektarbeit PCR-Systeme zum Nachweis<br />
von C. coli und C. jejuni sowie von Y. enterocolitica etabliert<br />
und diese anschließend mit den konventionellen kulturel-