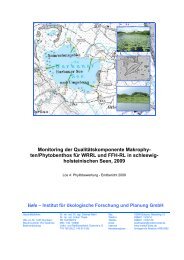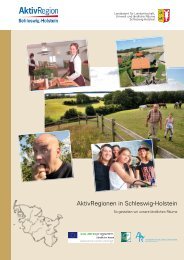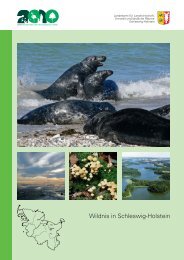Seen der Schwentine - Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ...
Seen der Schwentine - Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ...
Seen der Schwentine - Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
gend aus Schilf Phragmites australis zusammen.<br />
Vor allem am Nordostufer <strong>und</strong> am Südufer sind die<br />
Auswirkungen <strong>der</strong> früheren Beweidung noch immer<br />
zu erkennen. Hier bestehen noch immer mosaikartige<br />
Ersatzgesellschaften von beweidungstoleranten<br />
Arten, vor allem Kalmus Acorus calamus.<br />
Das Schilf konnte seine ursprüngliche Dominanz,<br />
vermutlich durch den hohen Fraßdruck <strong>der</strong><br />
Wasservögel, bisher nicht zurück gewinnen. Verlandungsschilf<br />
auf organischen Böden findet man<br />
in den Buchten des Westufers. An <strong>der</strong> Wasserlinie<br />
wächst das Schilf hier auf instabilen Schilftorfmudden.<br />
Am Außensaum sind schwimmende Matten<br />
aus Wasserschierling Cicuta virosa, Scheinzypersegge<br />
Carex pseudocyperus, Flussampfer Rumex<br />
hydrolapathum <strong>und</strong> Wassersumpfkresse Rorippa<br />
amphibia ausgebildet. Wasserröhrichte, d.h.<br />
auf permanent überflutetem Boden wachsende<br />
Röhrichte, kommen außer an <strong>der</strong> <strong>Schwentine</strong> im<br />
Übergang zum Kirchsee ebenfalls nur an <strong>der</strong> Kührener<br />
Halbinsel <strong>und</strong> am gegenüberliegenden Ostufer<br />
vor. Sie siedeln lediglich bis zu einer Wassertiefe<br />
von 0,6 bis 0,8 m. Auf weite Strecken ist<br />
dem Schilfröhricht hier wasserseitig ein schmaler<br />
Saum von Schmalblättrigem Rohrkolben Typha<br />
angustifolia vorgelagert. Die Röhrichte sind in<br />
weiten Bereichen geschädigt. Schilfstoppelfel<strong>der</strong><br />
vor <strong>der</strong> wasserseitigen Front weisen hier wie in<br />
an<strong>der</strong>en Bereichen, in denen das Wasserschilf<br />
völlig verschw<strong>und</strong>en ist, auf die ursprüngliche<br />
Ausdehnung <strong>der</strong> Röhrichte. In Bereichen, in denen<br />
die Röhrichte seit Jahrhun<strong>der</strong>ten beweidet werden,<br />
finden sich dagegen keine Stoppelfel<strong>der</strong>. Insgesamt<br />
wird <strong>der</strong> Rückgang aber nicht als so stark<br />
eingeschätzt wie in an<strong>der</strong>en schleswig-holsteinischen<br />
<strong>Seen</strong>.<br />
In den ruhigen Buchten ist dem Röhricht ein<br />
Schwimmblattgürtel mit Gelber Teichrose Nuphar<br />
lutea <strong>und</strong> Weißer Seerose Nymphaea alba vorgelagert.<br />
An Unterwasserpflanzen wurden 23 Arten (ohne<br />
submerse Formen von Röhrichtpflanzen) gef<strong>und</strong>en,<br />
davon sieben Arten Armleuchteralgen. Bei den<br />
festgestellten Arten handelt es sich größtenteils<br />
um belastungstolerante Arten mit weiter ökologischer<br />
Amplitude. Zu den charakteristischen Arten<br />
des Sees gehören das Kammlaichkraut Potamogeton<br />
pectinatus, das Zwerglaichkraut Potamogeton<br />
pusillus, das nach <strong>der</strong> Roten Liste <strong>der</strong> Farn <strong>und</strong><br />
Blütenpflanzen Schleswig-Holsteins (MIERWALD &<br />
BELLER 1990) als gefährdet eingestuft wird<br />
(RL 3), sowie das Durchwachsene Laichkraut Potamogeton<br />
perfoliatus, die Zerbrechliche Armleuchteralge<br />
Chara globularis <strong>und</strong> <strong>der</strong> Spreizende<br />
Wasserhahnenfuß Ranunculus circinatus. Diese<br />
Arten sind <strong>für</strong> basen- <strong>und</strong> nährstoffreiche <strong>Seen</strong><br />
des schleswig-holsteinischen Östlichen Hügellandes<br />
charakteristisch. Auch die eingewan<strong>der</strong>te<br />
Lanker See<br />
Art Nutalls Wasserpest Elodea nutallii, die in<br />
Schleswig-Holstein in starker Ausbreitung begriffen<br />
ist, wurde im Lanker See festgestellt. Unter<br />
den gef<strong>und</strong>enen Armleuchteralgen sind mehrere in<br />
Schleswig-Holstein sehr seltene Arten wie die<br />
Stachelspitzige Glanzarmleuchteralge Nitella mucronata<br />
(RL 1) <strong>und</strong> die Knäuelarmleuchteralge Tolypella<br />
glomerata (RL 2). Gefährdete Arten sind auch<br />
unter den untergetaucht lebenden Moosen (Gemeines<br />
Brunnenmoos Fontinalis antipyretica, RL 3)<br />
<strong>und</strong> den höheren Pflanzen (Herbstwasserstern<br />
Callitriche hermaphroditica, RL 2) vertreten. Diese<br />
lichtbedürftigen Arten treten im Lanker See nur im<br />
Flachwasserbereich auf, <strong>der</strong> nach Verdrängung<br />
des Röhrichts durch Beweidung zur Verfügung<br />
stand. Damit waren Bedingungen erfüllt, die trotz<br />
starker Nährstoffbelastung das Überleben von<br />
kleinen Beständen von seltenen Wasserpflanzen<br />
erlaubten.<br />
Von GARNIEL wurde auch ein Vergleich <strong>der</strong> eigenen<br />
Untersuchungen mit <strong>der</strong> Vegetationskartierung<br />
des <strong>Landesamt</strong>es <strong>für</strong> Wasserhaushalt <strong>und</strong> Küsten<br />
von 1986 (LW 1989) vorgenommen. Trotz <strong>der</strong><br />
unterschiedlichen Methodik wurde deutlich, dass<br />
sich die Tauchblattpflanzen im Lanker See deutlich<br />
in die Tiefe ausgebreitet haben, ein Indiz <strong>für</strong> verbesserte<br />
Lichtverhältnisse im Wasser <strong>und</strong> damit<br />
eine Verringerung <strong>der</strong> Trophie. Die Zunahme <strong>der</strong><br />
Tiefenausdehnung lag, je nach Art, zwischen 1<br />
<strong>und</strong> 2 m. Die 1986 geringe Artenzahl (13 Arten)<br />
führt GARNIEL dagegen auf Unterschiede in <strong>der</strong><br />
Untersuchungsmethode zurück. Ein Vergleich mit<br />
einer Arbeit aus den 1930er Jahren (SAUER 1937<br />
nach GARNIEL 2002) weist darauf hin, dass <strong>der</strong><br />
Lanker See bereits damals einen eutrophen Zustand<br />
aufwies.<br />
In einem älteren Bericht (LANDESAMT FÜR<br />
NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE<br />
1990) wird dargestellt, dass die Ufer noch 1986<br />
beweidet wurden (bes. Nordufer, gesamtes Südufer,<br />
einzelne Strecken des Westufers) <strong>und</strong> weitgehend<br />
röhrichtfrei waren. In dieser Veröffentlichung<br />
sind darüber hinaus frühere Nutzungen <strong>der</strong><br />
Ufer, größtenteils aus Informationen aus <strong>der</strong> topografischen<br />
Karte von 1877, zusammengefasst:<br />
Weite Bereiche <strong>der</strong> Ufer wurden bereits im 19.<br />
Jahrhun<strong>der</strong>t beweidet. Im Bereich <strong>der</strong> Halbinsel<br />
<strong>und</strong> des heutigen NSG am Westufer <strong>und</strong> gegenüber<br />
liegend am Ostufer westlich Vogelsang<br />
wurde Torf gestochen. Eine Bucht nördlich von<br />
Freudenholm war bereits trocken gelegt. Diese<br />
Fläche wurde Anfang <strong>der</strong> 1980er Jahre aus <strong>der</strong><br />
Nutzung genommen <strong>und</strong> entwickelte sich zu einem<br />
Sumpfgebiet.<br />
Insgesamt ist die Vegetation des Lanker Sees mit<br />
über 360 Arten ungewöhnlich artenreich. 33 Arten<br />
- in erster Linie handelt es sich um Arten des ex-<br />
115