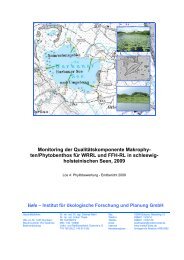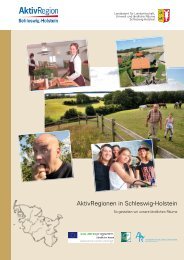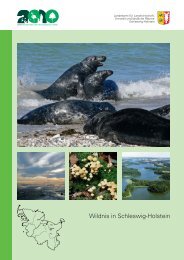Seen der Schwentine - Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ...
Seen der Schwentine - Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ...
Seen der Schwentine - Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Kellersee<br />
stände sind in diesen Bereichen entwe<strong>der</strong> völlig<br />
zurückgegangen o<strong>der</strong> nur noch sehr lückig bzw.<br />
inselartig vorhanden. Die in den meisten Bereichen<br />
recht gut ausgeprägte <strong>und</strong> verhältnismäßig artreiche<br />
Unterwasservegetation dagegen kann trotz<br />
stellenweise vorhandener Störung durch Grünalgenmatten<br />
als von landesweiter Bedeutung eingestuft<br />
werden.<br />
Freiwasser<br />
Der Kellersee wies 2002 während des gesamten<br />
Sommers eine gut ausgeprägte, stabile thermische<br />
Schichtung auf (Abbildung 36). Bei<br />
Calciumkonzentrationen um 68 mg/l (Frühjahr) war<br />
<strong>der</strong> See mit einer Säurekapazität um 3,0 mmol/l<br />
(Frühjahr) gut gepuffert. Die pH-Werte lagen im<br />
Oberflächenwasser zwischen 8,3 <strong>und</strong> 8,8. Die<br />
elektrische Leitfähigkeit im Oberflächenwasser<br />
schwankte zwischen 42 <strong>und</strong> 48 mS/m, <strong>und</strong> war<br />
damit im mittleren Bereich (Abbildung 37).<br />
Die Gesamtphosphorkonzentration war im Frühjahr<br />
mit 0,13 mg/l P eher hoch. Ob die Gesamtphosphorkonzentration<br />
zur Frühjahrszirkulation in<br />
Jahren mit weniger extremen Februar-<br />
Nie<strong>der</strong>schlägen geringer ist, bleibt zu vermuten.<br />
Die Stickstoffkonzentrationen lagen mit Frühjahrswerten<br />
um 1,7 mg/l N im mittleren Bereich.<br />
Anorganisch gelöster Stickstoff war stets vorhanden,<br />
während beim anorganisch gelösten Phosphor<br />
im Sommer nur sehr geringe Konzentrationen gemessen<br />
wurden. Phosphor stellte damit über die<br />
längste Zeit des Beobachtungszeitraums den Minimumfaktor<br />
<strong>für</strong> das Phytoplanktonwachstum dar.<br />
Im Februar war <strong>der</strong> Kellersee vollständig durchmischt<br />
<strong>und</strong> <strong>der</strong> Sauerstoffhaushalt war mit knapp<br />
100 % nahezu ausgeglichen (Abbildung 38). Der<br />
Gesamtphosphor lag fast gänzlich als gelöstes<br />
Phosphat vor, <strong>und</strong> <strong>der</strong> Gesamtstickstoff bestand<br />
zum größten Teil aus gelöstem Nitrat. Das Biovolumen<br />
des Phytoplanktons war zu dieser frühen<br />
Jahreszeit mit 0,35 mm³/l (2,4 µg/l Chlorophyll a,<br />
Sichttiefe: 3,1 m) noch sehr gering. Es bestand<br />
überwiegend aus Cryptophyceen (Rhodomonas<br />
sp.) sowie aus solitären centrischen Kieselalgen<br />
(SPETH & SPETH, 2002).<br />
Im Juni hatte sich eine thermische Schichtung mit<br />
einer Sprungschicht zwischen 5 <strong>und</strong> 8 m ausgebildet.<br />
Das Phytoplankton-Biovolumen war mit<br />
0,95 mm³/l (Chlorophyll a: 11 µg/l, Sichttiefe:<br />
2,9 m) relativ gering. Die hohe Sauerstoffsättigung<br />
von 130 %, <strong>der</strong> nahezu vollständige Verbrauch<br />
des gelösten Phosphats <strong>und</strong> die deutliche Abnahme<br />
des Nitrats im Oberflächenwasser weisen aber<br />
deutlich auf die Produktivität des Phytoplanktons<br />
hin. Die Phytoplanktongemeinschaft wurde zu<br />
diesem Zeitpunkt von Grünalgen dominiert, wobei<br />
koloniebildende Vertreter <strong>der</strong> Gattung Coelastrum<br />
62<br />
gegenüber besser fressbaren einzelligen Arten<br />
überwogen. Blaualgen (überwiegend Anabaena<br />
spp.) erreichten einen Anteil von 16 % am Gesamtbiovolumen.<br />
Zooplankter waren nur in geringen<br />
Ab<strong>und</strong>anzen vorhanden. Unterhalb <strong>der</strong><br />
Sprungschicht wurde ein Sauerstoffschw<strong>und</strong><br />
sichtbar, die Sättigung erreichte bei 12 m Tiefe<br />
50 %, in <strong>der</strong> unteren Wasserschicht bei 25 m war<br />
jedoch noch 14 % Sättigung vorhanden. Eine Nitratzehrung<br />
war noch nicht sichtbar.<br />
Im Juli hatte sich die Sprungschicht in die Tiefe<br />
verlagert, sie lag jetzt zwischen 12 <strong>und</strong> 13 m<br />
Wassertiefe. Die Phytoplanktonbiomasse erreichte<br />
mit einem Biovolumen von 0,92 mm³/l <strong>und</strong> einer<br />
Chlorophyll a -Konzentration von 8,8 µg/l (Sichttiefe<br />
2,1 m) ein ähnlich niedriges Niveau wie im<br />
Vormonat. Es dominierten Dinoflagellaten (Ceratium<br />
sp., 67 %) <strong>und</strong> Cryptophyceen (21 %), beides<br />
begeißelte, bewegliche Formen. Im Zooplankton<br />
erlangten Rä<strong>der</strong>tiere eine etwas größere Dichte,<br />
auch <strong>der</strong> Wasserfloh Bosmina coregoni wurde nun<br />
in etwas höherer Individuenzahl gef<strong>und</strong>en. Der<br />
Gesamtstickstoff, vor allem <strong>der</strong> Nitratanteil, hatte<br />
im Oberflächenwasser deutlich abgenommen. Im<br />
Tiefenwasser waren Zehrungsprozesse zu beobachten.<br />
Das Hypolimnion war vollständig sauerstofffrei,<br />
Nitrat war zwar noch vorhanden, sehr<br />
hohe Nitritkonzentrationen (über 0,2 mg/l N) waren<br />
jedoch ein Hinweis <strong>für</strong> die intensive Denitrifikation.<br />
Abbauprodukte wie Hydrogenkarbonat,<br />
Phosphat <strong>und</strong> Ammonium hatten sich aber nur in<br />
vergleichsweise mäßigen Konzentrationen angereichert.<br />
Im September hatte sich die Sprungschicht wie<strong>der</strong><br />
in die oberen Wasserschichten zwischen 4 <strong>und</strong><br />
9 m verlagert, war aber weniger scharf ausgeprägt.<br />
Die Phytoplanktonbiomasse verzeichnete im<br />
Vergleich zum Vormonat mit einem Biovolumen<br />
von 7,6 mm³/l (33 µg/l Chlorophyll a, 1,4 m Sichttiefe)<br />
einen deutlichen Zuwachs. Zu dieser hohen<br />
Phytoplanktonbiomasse trugen hauptsächlich Dinoflagellaten<br />
(Ceratium spp.) mit 53%, <strong>und</strong> Cyanobakterien<br />
mit 45 % (Microcystis spp., Aphanizomenon<br />
spp.) bei. Rä<strong>der</strong>tiere waren noch immer<br />
vergleichsweise häufig, größere Zooplankter erreichten<br />
hingegen nur noch geringe Individuendichten.<br />
Der Gesamtphosphor im Oberflächenwasser<br />
nahm deutlich zu. Diese Zunahme wurde durch<br />
Einmischung von P-reichen Wasser durch vorübergehende<br />
Verlagerung <strong>der</strong> Sprungschicht o<strong>der</strong><br />
durch phosphorreicheres <strong>Schwentine</strong>wasser verursacht.<br />
Nitrat war im Oberflächenwasser jetzt fast<br />
völlig aufgezehrt, möglicherweise ein Gr<strong>und</strong> <strong>für</strong><br />
das Erscheinen <strong>der</strong> zur Fixierung von Luftstickstoff<br />
befähigten Aphanizomenon-Arten. Im unteren<br />
Bereich <strong>der</strong> Sprungschicht (bei 10 m) war noch<br />
Nitrat vorhanden, ein kleiner Nitritpeak<br />
(0,06 mg/l N) zeigt Denitrifikation an. Im Tiefenwasser<br />
war das Nitrat durch Denitrifikation völlig<br />
aufgebraucht, <strong>und</strong> Schwefelwasserstoffgeruch