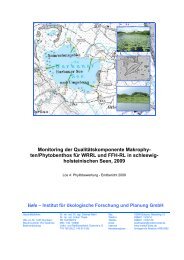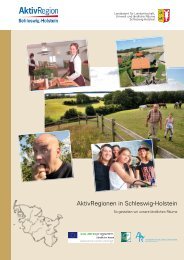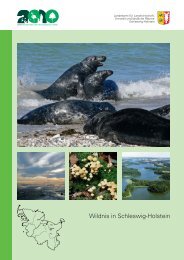Seen der Schwentine - Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ...
Seen der Schwentine - Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ...
Seen der Schwentine - Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Ostufer ein über 1 ha großer Bestand <strong>der</strong> stark<br />
gefährdeten Binsenschneide Cladium mariscus (RL<br />
2). Recht häufig tritt außerdem <strong>der</strong> gefährdete<br />
Sumpffarn Thelypteris palustris (RL 3) auf.<br />
Artenreiches Feuchtgrünland findet sich nur auf<br />
einer kleinen Fläche im Nordosten sowie als Brachestadium<br />
im Bereich <strong>der</strong> Landzunge am<br />
<strong>Schwentine</strong>abfluss. Beide Flächen weisen hohe<br />
Anteile von Sauergräsern auf, auf <strong>der</strong> Brache<br />
scheint sich überdies Schilf Phragmites australis<br />
auszudehnen. Im Südwesten südlich <strong>der</strong> <strong>Schwentine</strong><br />
existiert ein durch Überstauung von Grünland<br />
entstandenes, mehrere Hektar großes Feuchtgebiet,<br />
in dem offene Wasserflächen, ausgedehnte<br />
Röhrichte <strong>und</strong> im Randbereich auch Gehölzflächen<br />
eng miteinan<strong>der</strong> verzahnt sind.<br />
Ein Röhrichtgürtel ist auf knapp zwei Drittel <strong>der</strong><br />
Gesamtuferlänge ausgebildet. Die größten geschlossenen<br />
Vorkommen finden sich vor den<br />
bewaldeten Ufern im Norden, Osten <strong>und</strong> Süden.<br />
Im Siedlungsbereich von Malente, Sielbeck-Uklei<br />
<strong>und</strong> Fissau sind die Röhrichte meist nur lückig o<strong>der</strong><br />
inselhaft entwickelt. Hauptbestandsbildner ist<br />
Schilf Phragmites australis, vereinzelt dominiert<br />
aber auch die Seebinse Schoenoplectus lacustris,<br />
die neben eigenen Beständen streckenweise den<br />
Schilfröhrichten seewärts vorgelagert sind. Nur<br />
kleine Beständen bilden Schmal- <strong>und</strong> Breitblättriger<br />
Rohrkolben Typha angustifolia, T. latifolia, Kalmus<br />
Acorus calamus, Aufrechter Igelkolben Sparganium<br />
erectum <strong>und</strong> Sumpfsegge Carex acutiformis.<br />
Der Röhrichtgürtel ist durchschnittlich 10 m breit,<br />
vor einigen bewaldeten Ufern werden auch 15 bis<br />
20 m, vereinzelt auch bis 30 m, erreicht. Schilf<br />
wie Seebinse wachsen i.d.R. bis zu einer Wassertiefe<br />
von etwa 1 m, vereinzelt aber auch bis 1,4 m<br />
bzw. 1,5 m. Am Ostufer in <strong>der</strong> Sielbecker Bucht<br />
finden sich seewärtig bis 1 m Wassertiefe auf<br />
größeren jetzt vegetationsfreien Flächen Rhizomreste.<br />
Ein Rückgang <strong>der</strong> Röhrichtbestände wurde<br />
bereits 1983 beobachtet (LW 1993), er scheint<br />
seit dem weiter fortgeschritten zu sein. Die Ursachen<br />
sind vielfältig, wie bei den meisten <strong>Seen</strong> des<br />
Plöner Gebietes spielte beim Rückgang aber vermutlich<br />
die Erholungsnutzung eine große Rolle,<br />
während <strong>der</strong> Fraß durch Wasservögel die Wie<strong>der</strong>ausbreitung<br />
verhin<strong>der</strong>t.<br />
Größere Bestände von Schwimmblattpflanzen<br />
kommen vor allem am Westufer vor, kleinere Vorkommen<br />
finden sich vereinzelt am Nordufer sowie<br />
in zwei Buchten des waldbestandenen Südufers.<br />
Dominierende Art ist die Gelbe Teichrose Nuphar<br />
lutea. In den größeren Beständen, die bis etwa<br />
0,5 ha Flächenausdehnung erreichen, tritt meist<br />
auch die Weiße Seerose Nymphaea alba auf. Beide<br />
Arten erreichen Siedlungstiefen von max. 2 bzw.<br />
1,6 m. Als weitere Schwimmblattart bildete <strong>der</strong><br />
Wasserknöterich Polygonum amphibium am nördlichen<br />
Westufer <strong>und</strong> am mittleren Südufer einzelne<br />
Kellersee<br />
mittelgroße Bestände bis etwa 1,5 m Wassertiefe<br />
aus.<br />
Unterwasserpflanzen kommen in allen Bereichen<br />
des Ufers in mehr o<strong>der</strong> weniger gut ausgeprägten<br />
Beständen bis 3 m, vereinzelt auch über 4 m Wassertiefe<br />
vor. Sie sind wesentlich durch das Kammlaichkraut<br />
Potamogeton pectinatus geprägt, das<br />
meist Wassertiefen bis 2 m besiedelt. Insgesamt<br />
wurde 12 Arten an Unterwasserpflanzen gef<strong>und</strong>en,<br />
davon zwei Armleuchteralgen-Arten. Drei <strong>der</strong><br />
gef<strong>und</strong>enen Arten waren als gefährdet eingestuft.<br />
Im flacheren Wasser häufig war <strong>der</strong> Sumpfteichfaden<br />
Zannichellia palustris. In Wassertiefen<br />
von etwa 2,5 bis über 3 m dominierten vielfach<br />
Bestände des stark gefährdeten Stachelspitzigen<br />
Laichkrauts Potamogeton friesii (RL 2) <strong>und</strong> des<br />
gefährdeten Zwerglaichkrauts Potamogeton pusillus<br />
(RL 3). Weitere, relativ häufige Arten waren<br />
das Durchwachsene Laichkraut Potamogeton perfoliatus<br />
<strong>und</strong> <strong>der</strong> Spreizende Wasserhahnenfuß<br />
Ranunculus circinatus, die bis maximal 3,5 m<br />
Wassertiefe auftraten. Nur verstreut fanden sich<br />
Krauses Laichkraut Potamogeton crispus <strong>und</strong> die<br />
Kanadische Wasserpest Elodea canadensis, die<br />
vermehrt im Westteil des Sees in <strong>der</strong> Malenter<br />
Bucht gef<strong>und</strong>en wurde. Vor dem Mündungsbereich<br />
<strong>der</strong> Malenter Au trat im See <strong>der</strong> Einfache<br />
Igelkolben Sparganium emersum bis in 2,5 m<br />
Wassertiefe auf. Zerstreut in verschiedenen Uferbereichen,<br />
dabei vereinzelt bis 3,1 m Wassertiefe,<br />
siedelte die Schwanenblume Butomus umbellatus,<br />
das Rauhe Hornblatt Ceratophyllum demersum<br />
fand sich nur in einer Bucht am Nordufer. Armleuchteralgen<br />
fanden sich in fast allen Uferabschnitten,<br />
aber nur in vereinzelten Exemplaren<br />
bzw. kleinen Beständen, die in keinem Fall flächigen<br />
Charakter hatten. Es handelte sich fast ausschließlich<br />
um die gefährdete Gegensätzliche Armleuchteralge<br />
Chara contraria (RL 3; GARNIEL &<br />
HAMANN 2002), in einem Fall trat auch die Zerbrechliche<br />
Armleuchteralge Chara globularis auf.<br />
Die Unterwasservegetation scheint sich in ihrer<br />
Ausdehnung seit den 80er Jahren (LANDESAMT<br />
FÜR WASSERHAUSHALT UND KÜSTEN<br />
SCHLESWIG-HOLSTEIN 1993) nur wenig verän<strong>der</strong>t<br />
zu haben. Unterschiede in <strong>der</strong> Artenzusammensetzung<br />
gab es vor allem bei den Laichkräutern:<br />
Potamogeton pusillus <strong>und</strong> P. friesii haben<br />
sich ausgedehnt, P. lucens wurde 2001 nicht<br />
mehr gef<strong>und</strong>en. Ebenso war das Ährige Tausendblatt<br />
Myriophyllum spicatum, das 1983 im Kellersee<br />
gef<strong>und</strong>en wurde, nicht mehr vorhanden.<br />
In vielen Uferbereichen traten z.T. auch größere<br />
Polster fädiger Grünalgen auf.<br />
Insgesamt ist am Kellersees die Ufervegetation<br />
oberhalb <strong>der</strong> Wasserlinie in weiten Bereichen<br />
durch die anliegenden Siedlungen geprägt. Uferbefestigungen,<br />
Steganlagen, Badestellen <strong>und</strong> Bootsstege<br />
bestimmen hier das Bild. Die Röhrichtbe-<br />
61