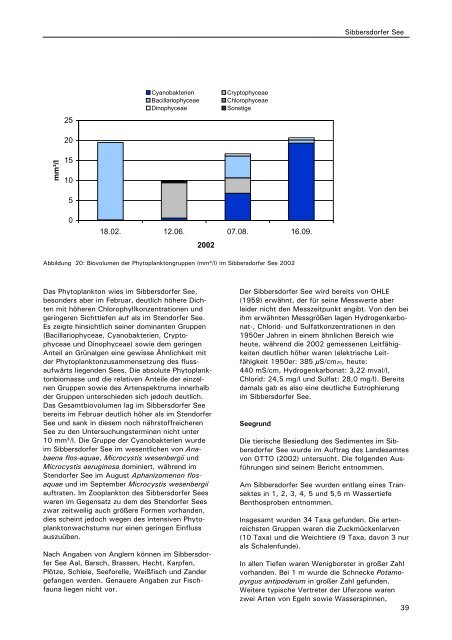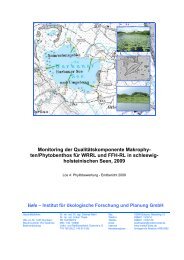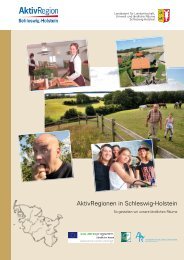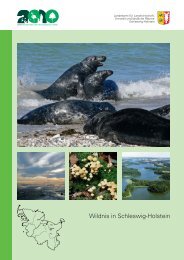Seen der Schwentine - Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ...
Seen der Schwentine - Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ...
Seen der Schwentine - Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
mm³/l<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
Cyanobakterien Cryptophyceae<br />
Bacillariophyceae Chlorophyceae<br />
Dinophyceae Sonstige<br />
18.02. 12.06. 07.08. 16.09.<br />
2002<br />
Abbildung 20: Biovolumen <strong>der</strong> Phytoplanktongruppen (mm³/l) im Sibbersdorfer See 2002<br />
Das Phytoplankton wies im Sibbersdorfer See,<br />
beson<strong>der</strong>s aber im Februar, deutlich höhere Dichten<br />
mit höheren Chlorophyllkonzentrationen <strong>und</strong><br />
geringeren Sichttiefen auf als im Stendorfer See.<br />
Es zeigte hinsichtlich seiner dominanten Gruppen<br />
(Bacillariophyceae, Cyanobakterien, Cryptophyceae<br />
<strong>und</strong> Dinophyceae) sowie dem geringen<br />
Anteil an Grünalgen eine gewisse Ähnlichkeit mit<br />
<strong>der</strong> Phytoplanktonzusammensetzung des flussaufwärts<br />
liegenden Sees. Die absolute Phytoplanktonbiomasse<br />
<strong>und</strong> die relativen Anteile <strong>der</strong> einzelnen<br />
Gruppen sowie des Artenspektrums innerhalb<br />
<strong>der</strong> Gruppen unterschieden sich jedoch deutlich.<br />
Das Gesamtbiovolumen lag im Sibbersdorfer See<br />
bereits im Februar deutlich höher als im Stendorfer<br />
See <strong>und</strong> sank in diesem noch nährstoffreicheren<br />
See zu den Untersuchungsterminen nicht unter<br />
10 mm³/l. Die Gruppe <strong>der</strong> Cyanobakterien wurde<br />
im Sibbersdorfer See im wesentlichen von Anabaena<br />
flos-aquae, Microcystis wesenbergii <strong>und</strong><br />
Microcystis aeruginosa dominiert, während im<br />
Stendorfer See im August Aphanizomenon flosaquae<br />
<strong>und</strong> im September Microcystis wesenbergii<br />
auftraten. Im Zooplankton des Sibbersdorfer Sees<br />
waren im Gegensatz zu dem des Stendorfer Sees<br />
zwar zeitweilig auch größere Formen vorhanden,<br />
dies scheint jedoch wegen des intensiven Phytoplanktonwachstums<br />
nur einen geringen Einfluss<br />
auszuüben.<br />
Nach Angaben von Anglern können im Sibbersdorfer<br />
See Aal, Barsch, Brassen, Hecht, Karpfen,<br />
Plötze, Schleie, Seeforelle, Weißfisch <strong>und</strong> Zan<strong>der</strong><br />
gefangen werden. Genauere Angaben zur Fischfauna<br />
liegen nicht vor.<br />
Sibbersdorfer See<br />
Der Sibbersdorfer See wird bereits von OHLE<br />
(1959) erwähnt, <strong>der</strong> <strong>für</strong> seine Messwerte aber<br />
lei<strong>der</strong> nicht den Messzeitpunkt angibt. Von den bei<br />
ihm erwähnten Messgrößen lagen Hydrogenkarbonat-,<br />
Chlorid- <strong>und</strong> Sulfatkonzentrationen in den<br />
1950er Jahren in einem ähnlichen Bereich wie<br />
heute, während die 2002 gemessenen Leitfähigkeiten<br />
deutlich höher waren (elektrische Leitfähigkeit<br />
1950er: 385 µS/cm20, heute:<br />
440 mS/cm, Hydrogenkarbonat: 3,22 mval/l,<br />
Chlorid: 24,5 mg/l <strong>und</strong> Sulfat: 28,0 mg/l). Bereits<br />
damals gab es also eine deutliche Eutrophierung<br />
im Sibbersdorfer See.<br />
Seegr<strong>und</strong><br />
Die tierische Besiedlung des Sedimentes im Sibbersdorfer<br />
See wurde im Auftrag des <strong>Landesamt</strong>es<br />
von OTTO (2002) untersucht. Die folgenden Ausführungen<br />
sind seinem Bericht entnommen.<br />
Am Sibbersdorfer See wurden entlang eines Transektes<br />
in 1, 2, 3, 4, 5 <strong>und</strong> 5,5 m Wassertiefe<br />
Benthosproben entnommen.<br />
Insgesamt wurden 34 Taxa gef<strong>und</strong>en. Die artenreichsten<br />
Gruppen waren die Zuckmückenlarven<br />
(10 Taxa) <strong>und</strong> die Weichtiere (9 Taxa, davon 3 nur<br />
als Schalenf<strong>und</strong>e).<br />
In allen Tiefen waren Wenigborster in großer Zahl<br />
vorhanden. Bei 1 m wurde die Schnecke Potamopyrgus<br />
antipodarum in großer Zahl gef<strong>und</strong>en.<br />
Weitere typische Vertreter <strong>der</strong> Uferzone waren<br />
zwei Arten von Egeln sowie Wasserspinnen,<br />
39