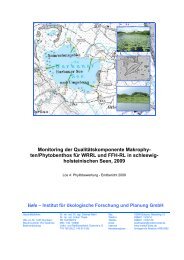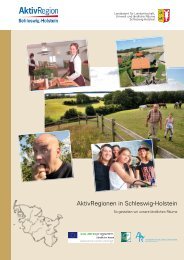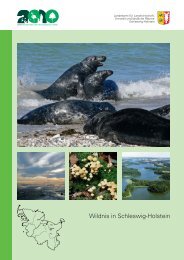Seen der Schwentine - Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ...
Seen der Schwentine - Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ...
Seen der Schwentine - Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Die <strong>Seen</strong> im Überblick<br />
Trotz dieses teilweise negativen Bildes zeigt <strong>der</strong><br />
Vergleich mit älteren Untersuchungen, dass in den<br />
letzten Jahrzehnten eine sichtbare Verbesserung<br />
<strong>der</strong> Trophieverhältnisse in den <strong>Seen</strong> <strong>der</strong> <strong>Schwentine</strong>kette<br />
stattgef<strong>und</strong>en hat. Außerdem ist erkennbar,<br />
dass hinsichtlich <strong>der</strong> Trophiekenngrößen<br />
Phosphorkonzentation, Sichttiefe <strong>und</strong> Chlorophyll<br />
a - Konzentration <strong>der</strong> gute ökologische Zustand<br />
gemäß Wasserrahmenrichtlinie beim Kellersee,<br />
Dieksee, Behler See <strong>und</strong> Großen Plöner See schon<br />
fast erreicht ist.<br />
Der Referenzrahmen <strong>für</strong> verschiedene chemische<br />
<strong>und</strong> physikalische Parameter in schleswigholsteinischen<br />
<strong>Seen</strong> (Abbildung 4) verdeutlicht die<br />
Lage <strong>der</strong> untersuchten <strong>Seen</strong> im regionalen Zusammenhang.<br />
Der Medianwert, das heißt, <strong>der</strong>jenige<br />
Wert, <strong>der</strong> in <strong>der</strong> Mitte <strong>der</strong> nach ihrer Größe geordneten<br />
Messwerte liegt, ist jeweils als waagerechte<br />
bzw. senkrechte Linie dargestellt. Zur Verdeutlichung<br />
<strong>der</strong> gegenseitigen Abhängigkeit <strong>der</strong> einzelnen<br />
<strong>Seen</strong> <strong>der</strong> Kette sind einige Messgrößen zusätzlich<br />
im Fließverlauf dargestellt, wobei auch die<br />
in diesem Bericht nicht dargestellten Gewässer<br />
Großer <strong>und</strong> Kleiner Plöner See einbezogen wurden.<br />
Überdurchschnittlich hohe Calciumkonzentrationen<br />
<strong>und</strong> ein hohes Säurebindungsvermögen zeichnete<br />
die im oberen Einzugsgebiet gelegenen <strong>Seen</strong> aus<br />
(Stendorfer See, Sibbersdorfer See, Großer Eutiner<br />
See, Keller See). Für quellnahe o<strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>wasser<br />
gespeiste Gewässer in kalkreichen Böden ist dies<br />
typisch. Im Verlauf <strong>der</strong> <strong>Schwentine</strong> wird immer<br />
mehr Calcium biogen ausgefällt (Abbildung 5).<br />
Dadurch verringert sich das Säurebindungsvermögen<br />
<strong>und</strong> die Pufferkapazität nimmt ab. Entsprechend<br />
hatten Behler See, Großer <strong>und</strong> Kleiner Plöner<br />
See, <strong>Schwentine</strong>see <strong>und</strong> Lanker See eher unterdurchschnittlich<br />
hohe Calciumkonzentrationen<br />
<strong>und</strong> Säurebindungsvermögen.<br />
Die Frühjahrskonzentrationen an Gesamtphosphor<br />
bewegten sich mit Ausnahme des Kleinen Plöner<br />
Sees (0,055 mg/l P) bei allen 2002 untersuchten<br />
<strong>Seen</strong> um 0,1 mg/l P <strong>und</strong> lagen damit über dem<br />
schleswig-holsteinischen Durchschnitt (Abbildung<br />
4). Der <strong>Schwentine</strong>see wies 2004<br />
0,064 mg/l P auf. In den ungeschichteten <strong>Seen</strong><br />
stieg die Phosphorkonzentration im Verlauf des<br />
Sommers stark an (z.B. auf das Dreifache im Sibbersdorfer<br />
See). Im Oberflächenwasser <strong>der</strong> stabil<br />
geschichteten <strong>Seen</strong> dagegen nahm sie deutlich ab,<br />
wie es charakteristisch <strong>für</strong> diesen Seetyp ist (z.B.<br />
auf 0,035 mg/l P im Kellersee).<br />
Beim Gesamtstickstoff zeichneten sich wie<strong>der</strong>um<br />
die im Fließverlauf in den <strong>Seen</strong> stattfindenden<br />
Prozesse ab (Abbildung 4 <strong>und</strong> 6): Der Stendorfer<br />
See zeigte die höchsten Konzentrationen, während<br />
von den 2002 untersuchten <strong>Seen</strong> <strong>der</strong> Lanker See<br />
die geringsten Konzentrationen aufwies, da im<br />
14<br />
Fließverlauf <strong>der</strong> <strong>Schwentine</strong> erheblich Mengen an<br />
Stickstoff durch Denitrifikation verloren gehen.<br />
Dadurch kam es phasenweise in mehreren <strong>Seen</strong><br />
zur Stickstofflimitierung des Phytoplanktonwachstums.<br />
Die <strong>Seen</strong> <strong>der</strong> unteren <strong>Schwentine</strong>,<br />
insbeson<strong>der</strong>e Großer <strong>und</strong> Kleiner Plöner See sowie<br />
<strong>der</strong> <strong>Schwentine</strong>see, hatten dadurch <strong>für</strong> eutrophe<br />
<strong>Seen</strong> ungewöhnlich niedrige N-Konzentrationen<br />
von unter 1 mg/l N <strong>und</strong> lagen hinsichtlich ihrer<br />
Stickstoffwerte unter dem schleswigholsteinischen<br />
Durchschnitt (Abbildung 4).<br />
Auch bei <strong>der</strong> Kieselsäureversorgung sind die im<br />
unteren Einzugsgebiet gelegenen <strong>Seen</strong> weitgehend<br />
von <strong>der</strong> Zulieferung aus <strong>der</strong> <strong>Schwentine</strong> <strong>und</strong> damit<br />
dem Verbrauch in den oberhalb gelegenen <strong>Seen</strong><br />
abhängig. Die sommerlichen Konzentrationen lagen<br />
daher in den <strong>Seen</strong> des oberen Einzugsgebiets<br />
am höchsten <strong>und</strong> waren von <strong>der</strong> mittleren Tiefe<br />
<strong>der</strong> <strong>Seen</strong> relativ unabhängig.<br />
Die höchsten sommerlichen Sichttiefen sowie die<br />
geringsten sommerlichen Chlorophyll-a- <strong>und</strong> Gesamtphosphorwerte<br />
hatten die vier tiefen <strong>Seen</strong><br />
Kellersee, Dieksee, Behler See <strong>und</strong> Großer Plöner<br />
See, während sich bei Stendorfer See, Sibbersdorfer<br />
See <strong>und</strong> Großem Eutiner See die umgekehrte<br />
Tendenz zeigte. Die Abhängigkeit zwischen <strong>der</strong><br />
mittlerer Tiefe eines Sees <strong>und</strong> <strong>der</strong> Chlorophyll a-<br />
Konzentration ist in Abbildung 5 gut zu erkennen.<br />
Auch zwischen Chlorophyll a <strong>und</strong> <strong>der</strong> theoretischen<br />
Wasseraufenthaltszeit ist eine Beziehung<br />
festzustellen. <strong>Seen</strong> mit kurzen Verweilzeiten sind<br />
in <strong>der</strong> Regel produktiver. Die Grenze bildet jedoch<br />
<strong>der</strong> Flusssee mit wenigen Tagen Aufenthaltszeit.<br />
Dort überwiegt <strong>der</strong> Durchspüleffekt mit <strong>der</strong> verb<strong>und</strong>enen<br />
Verdünnung <strong>und</strong> Verdriftung des Phytoplanktons.<br />
Die Phytoplanktongemeinschaften waren im Frühjahr<br />
insbeson<strong>der</strong>e in den ungeschichteten <strong>Seen</strong><br />
vom Typ 11 (kalkreich, ungeschichtet, fV > 1,5,<br />
Stendorfer See, Sibbersdorfer See, Großer Eutiner<br />
See, Lanker See) durch Kieselalgen geprägt, die<br />
bereits im Februar hohe Biovolumina erreichten.<br />
Charakteristisch <strong>für</strong> diese <strong>Seen</strong> war auch die Dominanz<br />
von Cyanobakterien, die bereits im Hochsommer<br />
zu beobachten war <strong>und</strong> sich teilweise,<br />
wie im Lanker See, bis in den November hineinzog.<br />
Während des Hochsommers wurden hauptsächlich<br />
stickstofffixierende Blaualgen-Arten vorgef<strong>und</strong>en.<br />
Im Herbst wurden diese jedoch in allen<br />
oberen ungeschichteten <strong>Schwentine</strong>seen von coccalen<br />
Formen (Microcystis spp.) abgelöst. Im<br />
<strong>Schwentine</strong>see (Typ 12) wurden Cyanobakterien<br />
im Jahr 2004 nur vorübergehend beobachtet, was<br />
vermutlich auf die zu kurze Wasseraufenthaltszeit<br />
zurückzuführen ist, die die Entwicklung einer Blüte<br />
verhin<strong>der</strong>t.