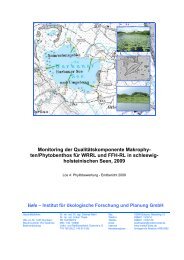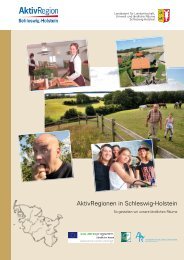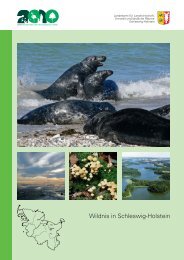Seen der Schwentine - Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ...
Seen der Schwentine - Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ...
Seen der Schwentine - Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Sibbersdorfer See<br />
Bedeutung eingestuft werden kann. In seinem<br />
Wert höher einzuschätzen ist <strong>der</strong> breit ausgebildete<br />
<strong>und</strong> naturnahe Verlandungsbereich im Nordwesten<br />
des Sees, <strong>der</strong> neben einer schön ausgebildeten<br />
Zonierung mit Schwimmblatt- <strong>und</strong> Röhrichtgürtel<br />
landseitig auch großflächig Feuchtgrünland mit<br />
zahlreichen gefährdeten Arten aufweist.<br />
Freiwasser<br />
Der Sibbersdorfer See wies im Sommer eine relativ<br />
schwache thermische Schichtung auf (Abbildung<br />
18). Bei Calciumkonzentrationen um 81 mg/l<br />
(Frühjahr) war <strong>der</strong> See mit einer Säurekapazität<br />
zwischen 3,1 <strong>und</strong> 3,8 mmol/l (Oberflächenwasser)<br />
sehr gut gepuffert. Die pH-Werte lagen zwischen<br />
8,5 <strong>und</strong> 9,0. Die elektrische Leitfähigkeit<br />
schwankte mit Werten zwischen 39 <strong>und</strong><br />
49 mS/m, war insgesamt aber eher gering.<br />
Die Gesamtphosphorkonzentrationen lagen mit<br />
0,092 mg/l P im Frühjahr in einem mittleren Bereich,<br />
stiegen im Verlauf des Sommers jedoch auf<br />
den sehr hohen Wert von 0,3 mg/l P (Abbildung<br />
29). Die Stickstoffkonzentrationen lagen mit einem<br />
Frühjahrswert von 3,4 mg/l N relativ hoch. Anorganisch<br />
gelöster Phosphor war stets vorhanden.<br />
Stickstoff stellte möglicherweise bereits im Juni<br />
den Minimumfaktor dar.<br />
Bereits Ende Februar zeigte sich im Sibbersdorfer<br />
See bei Sichttiefen von 0,6 m <strong>der</strong> Beginn <strong>der</strong> Entwicklung<br />
einer Frühjahrsblüte, die ein Biovolumen<br />
von 19,5 mm³/l bzw. ein Chlorophyll a-Gehalt von<br />
59 µg/l erreichte (Abbildung 20). Das Phytoplankton<br />
bestand fast ausschließlich aus centrischen<br />
Kieselalgen, insbeson<strong>der</strong>e Stephanodiscus-<br />
Arten, die trotz stetem Zustrom von <strong>Schwentine</strong>wasser<br />
die Silikatkonzentrationen auf unter 3 mg/l<br />
senken konnten (SPETH & SPETH 2002). Bei Gesamtphosphorkonzentrationen<br />
von 0,092 mg/l P<br />
war <strong>der</strong> Anteil des anorganisch gelösten Phosphats<br />
entsprechend gering (0,011 mg/l P). Anorganischer<br />
Stickstoff war als Nitrat noch reichlich<br />
vorhanden (2,3 mg/l N), erhöhte Nitritkonzentrationen<br />
(0,022 mg/l N) wiesen aber bereits auf Denitrifikationsprozesse<br />
hin. Obwohl <strong>der</strong> See vollständig<br />
durchmischt schien, wies das Tiefenwasser<br />
bereits eine leichte Sauerstoffuntersättigung<br />
auf (97 %). Zooplankton, ebenfalls von<br />
SPETH & SPETH (2002) analysiert, spielte im<br />
Februar noch keine Rolle. Lediglich Wimpertierchen<br />
erreichten eine gewisse Häufigkeit.<br />
Mitte Juni erreichte die Biomasse des Phytoplanktons<br />
ein geringfügig niedrigeres Niveau (53 µg/l<br />
Chlorophyll a, 9,9 mm³/l Biovolumen), es bestand<br />
nun überwiegend aus Cryptophyceen <strong>der</strong> Gattung<br />
Cryptomonas . Nun traten vermehrt Rä<strong>der</strong>tiere<br />
36<br />
auf, unter den Blattfußkrebsen war Bosmina coregoni<br />
häufiger. Die Gesamtphosphorkonzentrationen<br />
waren auf<br />
0,15 mg/l P gestiegen. Der Gesamtstickstoff lag<br />
überwiegend in organischer Form vor, während<br />
Nitrat kaum noch vorhanden war. Vermutlich führten<br />
intensive Denitrifikationsprozesse im flussaufwärts<br />
gelegenen Stendorfer See sowie auf <strong>der</strong><br />
sich anschliessenden Fließstrecke, zu einer drastischen<br />
Verringerung <strong>der</strong> Gesamtstickstoffkonzentration<br />
von 3,4 auf 1,5 mg/l N. Die Intensität <strong>der</strong><br />
Zehrungsprozesse ist an <strong>der</strong> Sauerstoffuntersättigung<br />
ab 3 m Wassertiefe erkennbar, die, obwohl<br />
kaum ein Temperaturunterschied zwischen Oberflächen-<br />
<strong>und</strong> Tiefenwasser bestand, bei 5 m Wassertiefe<br />
nur noch etwa 50 % betrug. Da bei den<br />
meisten Nährstoffen noch kein deutlicher Gradient<br />
ausgeprägt war, bestand die Schichtung vermutlich<br />
noch nicht sehr lange.<br />
Im August hatte sich mit 100 µg/l Chlorophyll a<br />
<strong>und</strong> einem Biovolumen von 21 mm³/l eine hohe<br />
Phytoplanktonbiomasse gebildet, die zu über 40 %<br />
aus Cyanobakterien <strong>der</strong> Gattung Microcystis <strong>und</strong><br />
<strong>der</strong> zur Stickstofffixierung befähigten Art Anabaena<br />
spiroides bestand. Neben Cyanobakterien wurde<br />
die Phytoplanktongemeinschaft durch zentrale<br />
Kieselalgen <strong>und</strong> Cryptophyceen dominiert. Im<br />
Zooplankton wurden vermehrt Blattfußkrebse,<br />
darunter neben Bosmina coregoni auch Chydorus<br />
sphaericus sowie Daphnia cucullata <strong>und</strong> Vertreter<br />
des D.-longispina-Komplexes gef<strong>und</strong>en. Auch Ru<strong>der</strong>fußkrebse,<br />
insbeson<strong>der</strong>e cyclopoide Vertreter,<br />
erreichten im August ihre höchste Individuendichte.<br />
Der anorganische Stickstoff war völlig aufgezehrt,<br />
sodass ein Wechsel von P- zu N-Limitation<br />
zu verzeichnen war. Das Tiefenwasser war bis zu<br />
einer Wassertiefe von 4 m sauerstofffrei, die<br />
Temperaturschichtung war jetzt mit einer Differenz<br />
von 3,6 °C etwas größer. Trotz <strong>der</strong> instabilen<br />
Schichtungsverhältnisse hatte sich bei den meisten<br />
Nährstoffen jetzt ein deutlicher Gradient eingestellt.<br />
Auffällig ist insbeson<strong>der</strong>e die Zunahme des<br />
Orthophosphats im Tiefenwasser auf 0,24 mg/l P.<br />
Im September war <strong>der</strong> Sibbersdorfer See schon<br />
wie<strong>der</strong> weitgehend durchmischt. Die<br />
Phytoplanktonbiomasse nahm im Vergleich zum<br />
Vormonat weiter zu (126 µg/l Chlorophyll a). Blaualgen<br />
machten jetzt 93 % <strong>der</strong> Biomasse aus,<br />
wobei Microcystis spp., vor allem M. aeruginosa,<br />
dominierten. Blattfußkrebse waren immer noch in<br />
vergleichsweise hoher Dichte vertreten. Der<br />
Anstieg des Phosphorgehaltes auf 0,3 mg/l P<br />
wurde vermutlich teils durch den Anstieg des<br />
Phosphorgehaltes in <strong>der</strong> <strong>Schwentine</strong> (siehe Stendorfer<br />
See) sowie teils durch die Einmischung von<br />
phosphorreichem Tiefenwasser mit Auflösung <strong>der</strong><br />
thermischen Schichtung verursacht. Bei minimalen<br />
Sichttiefen von 0,5 m wurde das Phytoplankton<br />
wahrscheinlich nicht nur durch Stickstofflimitation