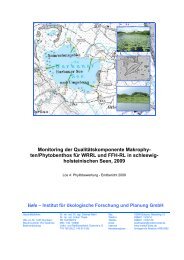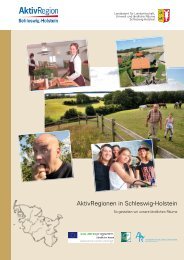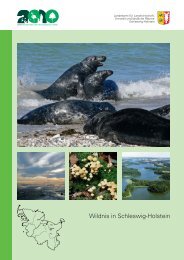Seen der Schwentine - Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ...
Seen der Schwentine - Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ...
Seen der Schwentine - Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
gend organisch vor. Im Tiefenwasser hatte eine<br />
Anreicherung <strong>der</strong> sedimentierten Nährstoffe<br />
(0,16 mg/l P, 1,6 mg/l N) stattgef<strong>und</strong>en. Das Hypolimnion<br />
wies aber auch in <strong>der</strong> untersten Schicht<br />
noch eine Sauerstoffsättigung von über 30 % auf.<br />
Im Juli hatte sich, wahrscheinlich infolge <strong>der</strong> starken<br />
Nie<strong>der</strong>schläge, die Sprungschicht in die Tiefe<br />
verlagert. Das Phytoplankton erreichte mit einem<br />
Biovolumen von 0,37 mm³/l (6,3 µg/l Chlorophyll<br />
a, 2,4 m Sichttiefe) eine noch geringere Biomasse<br />
als im Juni. Neben Cryptophyceen (44 %) waren<br />
mit je etwa 18 bis 20 % auch Kieselalgen, Jochalgen<br />
<strong>und</strong> Blaualgen (überwiegend Microcystis<br />
aeruginosa) beteiligt. Mit Ausnahme von Bosmina<br />
coregoni war jetzt kaum noch großes Zooplankton<br />
vorhanden. Da<strong>für</strong> traten vermehrt Ciliaten (Epistylis<br />
spp.) <strong>und</strong> Rä<strong>der</strong>tiere (vor allem Keratella cochlearis)<br />
auf. Beide Gruppen zählen eher zu den Detritusfressern,<br />
die sich möglicherweise aufgr<strong>und</strong><br />
des Eintrages von organischem Material während<br />
<strong>der</strong> Starkregenereignisse vermehrt entwickelt haben.<br />
Auf das Vorhandensein von Abbauprozessen<br />
organischer Biomasse deutet auch die Sauerstoffuntersättigung<br />
(90 %) im Oberflächenwasser. Im<br />
oberen Hypolimnion betrug die Sättigung noch<br />
etwa 10 %, unterhalb von 30 m Wassertiefe war<br />
das Tiefenwasser nahezu sauerstofffrei. Dort hatte<br />
nun Denitrifikation eingesetzt, erkennbar an den<br />
stark erhöhten Nitritwerten (>0,11 mg/l N). Die<br />
Anreicherung von Ammonium <strong>und</strong> Phosphat war<br />
noch immer recht gering.<br />
Im September hatte sich die Sprungschicht wie<strong>der</strong><br />
bei 10 m stabilisiert. Das Phytoplanktonbiovolumen<br />
erreichte mit 7,7 mm³/l (16,7 µg/l Chlorophyll<br />
a, 1,9 m Sichttiefe) das Maximum <strong>der</strong> im<br />
Beobachtungszeitraum gemessenen Werte <strong>und</strong><br />
wurde zu mehr als 80% von <strong>der</strong> Blaualge Microcystis<br />
aeruginosa dominiert. Zooplankter waren<br />
nur noch in geringer Dichte vorhanden. Der Phosphor<br />
im Oberflächenwasser lag jetzt fast vollständig<br />
partikulär geb<strong>und</strong>en vor <strong>und</strong> erreichte mit einer<br />
Konzentration von 0,038 mg/l P weiterhin recht<br />
niedrige Werte. Im Hypolimnion war die Zehrung<br />
bis zur völligen Sauerstofffreiheit fortgeschritten.<br />
Nitrat war in <strong>der</strong> Mitte des Hypolimnions noch<br />
vorhanden, die hohen Nitritwerte in dieser Tiefe<br />
zeigen, dass eine intensive Denitrifikation stattfand.<br />
Im unteren Hypolimnion war das Nitrat vollständig<br />
aufgezehrt. Dort hatte nun Desulfurikation<br />
eingesetzt, die an einem starken Schwefelwasserstoffgeruch<br />
deutlich wurde. Die Erhöhung<br />
<strong>der</strong> Phosphorwerte im Hypolimnion waren jedoch<br />
noch vergleichsweise gering (knapp 0,5 mg/l P)<br />
<strong>und</strong> daher nur auf Freisetzung aus frisch sedimentierten<br />
Algen zurückzuführen, eine P-<br />
Freisetzung aus dem Sediment fand vermutlich<br />
nicht statt.<br />
Dieksee<br />
Der Vergleich des Dieksees mit dem oberhalb gelegenen<br />
Kellersee zeigt hinsichtlich <strong>der</strong> Entwicklung<br />
<strong>der</strong> Phytoplanktonbiomasse einen sehr ähnlichen<br />
Verlauf. Dieser war dadurch gekennzeichnet,<br />
dass das Phytoplanktonbiovolumen bis Ende<br />
Juli nur sehr niedrige Werte < 1mm³/l erreichte<br />
<strong>und</strong> im September ein Maximum mit relativ hohen<br />
Biovolumina um 7-8 mm 3 /l zu verzeichnen war.<br />
Hinsichtlich <strong>der</strong> Zusammensetzung <strong>der</strong> Phytoplanktongemeinschaft<br />
fällt auf, dass diese in<br />
beiden <strong>Seen</strong> bis zum Frühsommer hin eine hohe<br />
Ähnlichkeit aufwies. Ab Juli entwickelten sich<br />
beide <strong>Seen</strong> jedoch unterschiedlich. Beson<strong>der</strong>s<br />
auffällig in diesem Zusammenhang ist <strong>der</strong> geringe<br />
Anteil von Dinoflagellaten im Dieksee, während<br />
diese im Kellersee im September mehr als 50%<br />
<strong>der</strong> gesamten Algenbiomasse ausmachten. Dennoch<br />
war das Phytoplankton bei<strong>der</strong> <strong>Seen</strong> im September<br />
durch einen Anstieg <strong>der</strong> Cyanobakterienbiomasse<br />
gekennzeichnet, <strong>der</strong> im Dieksee<br />
jedoch noch weitaus stärker ausgeprägt war. In<br />
beiden <strong>Seen</strong> war Microcystis aeruginosa die dominierende<br />
Art.<br />
Der Fischbestand des Dieksees setzt sich nach<br />
Auskunft von Anglern aus Aal, Barsch, Brassen,<br />
Hecht, Plötze, Weißfisch, Zan<strong>der</strong>, Kleiner <strong>und</strong><br />
Edelmaräne zusammen.<br />
Der Dieksee wurde bereits in den 1910er Jahren<br />
von THIENEMANN (1922) untersucht. Die Sauerstoffsättigung<br />
im unteren Hypolimnion lag zwischen<br />
1916 <strong>und</strong> 1920 gegen Ende <strong>der</strong> Sommerstagnation<br />
meist noch über 20 % <strong>und</strong> damit deutlich<br />
höher als heute. Bei einer weiteren Untersuchung<br />
vom Dieksee im August 1930 wurde neben<br />
<strong>der</strong> Vertikalverteilung von Zooplankton auch ein<br />
Sauerstoffprofil erhoben (NABER 1933). Das Metalimnion<br />
lag bei etwa 11 bis 13 m. Der Sauerstoffgehalt<br />
unterhalb <strong>der</strong> Sprungschicht betrug<br />
etwa 2 ccm/l (entspricht einer Sauerstoffsättigung<br />
von etwa 10 %) <strong>und</strong> sank dann ab etwa 30 m<br />
Wassertiefe rapide auf nahe Null. Dies kann als<br />
Anzeichen gewertet werden, dass bereits in den<br />
dreißiger Jahren des vergangen Jahrhun<strong>der</strong>ts erste<br />
Eutrophierungsprozesse im Dieksee eingesetzt<br />
hatten.<br />
1978 bis 1979 wurden das Freiwasser <strong>und</strong> die<br />
einmündenden Gewässer vom <strong>Landesamt</strong> <strong>für</strong><br />
Wasserhaushalt <strong>und</strong> Küsten untersucht<br />
(LANDESAMT FÜR WASSERHAUSHALT UND<br />
KÜSTEN SCHLESWIG-HOLSTEIN 1984). Der Vergleich<br />
mit älteren Daten ist aufgr<strong>und</strong> unterschiedlicher<br />
Analysenmethoden schwierig, es lassen sich<br />
jedoch folgende Trends erkennen:<br />
Es bestand damals we<strong>der</strong> Stickstoff- noch Phosphorlimitierung<br />
<strong>für</strong> das Phytoplanktonwachstum.<br />
Anorganischer Phosphor <strong>und</strong> anorganischer Stickstoff<br />
in Form von Ammonium <strong>und</strong> Nitrat waren<br />
75