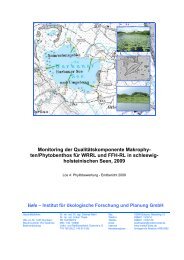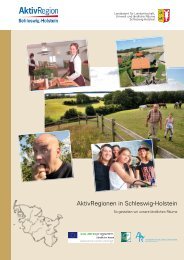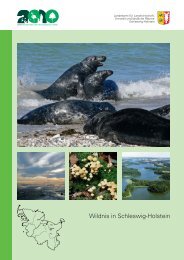Seen der Schwentine - Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ...
Seen der Schwentine - Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ...
Seen der Schwentine - Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Behler See<br />
Südufer fehlt das Schilf fast gänzlich, die hier<br />
vielfach noch zu beobachtenden Rhizomreste weisen<br />
auf einen stärkeren Bestandsrückgang <strong>der</strong> Art<br />
hin.<br />
Eine Schwimmblattzone aus <strong>der</strong> gelben Teichrose<br />
Nuphar lutea <strong>und</strong> <strong>der</strong> etwas seltener auftretenden<br />
weißen Seerose Nymphaea alba lässt sich nur<br />
punktuell in geschützten Lagen finden. Die gelbe<br />
Teichrose dringt bis in 2 m Wassertiefe vor. Zum<br />
Teil baut sie auch gemeinsam mit <strong>der</strong> weißen Seerose<br />
Bestände von 5 m Breite auf, in Ausnahmefällen<br />
können diese bis zu 50 m Länge <strong>und</strong> 10 m<br />
Breite erreichen. Der Wasser-Knöterich Polygonum<br />
amphibium, <strong>der</strong> im Behler See bis zu einer maximalen<br />
Wassertiefe von 1 m siedelt, ist in drei Beständen<br />
zwischen 10 <strong>und</strong> 80 m² am Übergang<br />
zum Höftsee, am mittleren Nordufer <strong>und</strong> im Langensee<br />
vertreten. Des Weiteren sind noch die<br />
Kleine Wasserlinse Lemna minor <strong>und</strong> die Vielwurzelige<br />
Teichlinse Spirodela polyrhiza verstreut<br />
meist im Flachwasser zwischen dem Röhricht im<br />
Gewässer vorhanden.<br />
Die Unterwasservegetation ist im Behler See insgesamt<br />
mit 14 submersen Arten, von denen fünf<br />
nach den Roten Listen <strong>der</strong> Farn- <strong>und</strong> Blütenpflanzen<br />
Schleswig-Holsteins (MIERWALD & BELLER<br />
1990) o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Armleuchteralgen Schleswig-<br />
Holsteins (GARNIEL & HAMANN 2002) gefährdet,<br />
beziehungsweise vom Aussterben bedroht sind,<br />
praktisch an <strong>der</strong> gesamten Uferlinie gut entwickelt.<br />
Nur im Ostteil, im Langensee, ist ihr Vorkommen<br />
etwas spärlicher. Die Bestände dehnen<br />
sich in Wassertiefen bis 5 m, zum Teil auch unter<br />
6 m, aus. Beson<strong>der</strong>s in Flachwasserbereichen ist<br />
<strong>der</strong> Sumpf-Teichfaden Zannichellia palustris häufig<br />
zu beobachten. Überall anzutreffen <strong>und</strong> den Bereich<br />
bis 2 m Wassertiefe vielfach beherrschend<br />
ist das Kamm-Laichkraut Potamogeton pectinatus.<br />
Sehr häufig in diesem Bereich kommt außerdem<br />
das Durchwachsene Laichkraut Potamogeton perfoliatus<br />
<strong>und</strong> <strong>der</strong> Spreizende Wasserhahnenfuß<br />
Ranunculus circinatus vor. Das Rauhe Hornblatt<br />
Ceratophyllum demersum <strong>und</strong> das gefährdete<br />
Zwerg-Laichkraut Potamogeton pusillus treten<br />
auch in größeren Beständen, wenn nicht sogar in<br />
Massenbeständen zum Beispiel westlich des Großen<br />
War<strong>der</strong>s, vermehrt in tieferen Bereichen auf.<br />
Häufig bis verstreut sind die Kanadische Wasserpest<br />
Elodea canadensis, das gefährdete Ährige<br />
Tausendblatt Myriophyllum spicatum <strong>und</strong> das<br />
stark gefährdete Stachelspitzige Laichkraut Potamogeton<br />
friesii im See zu finden. Der vom Aussterben<br />
bedrohte Grasblättrige Froschlöffel Alisma<br />
gramineum siedelt in Wassertiefen von 1 m bis um<br />
3 m vor allem am West- <strong>und</strong> Nordufer. Die gefährdete<br />
Gegensätzliche Armleuchteralge Chara<br />
contraria kommt vom Flachwasser bis unter 4 m<br />
Wassertiefe häufig vor, sie bildet am Nord- <strong>und</strong><br />
am Südufer sowie vor dem Westufer des Großen<br />
88<br />
War<strong>der</strong>s rasige, zum Teil großflächige Bestände,<br />
vor allem aber in Wassertiefen von 2 bis 3 m. Die<br />
Zerbrechliche Armleuchteralge Chara globularis<br />
tritt ebenfalls häufig in Erscheinung, allerdings in<br />
kleineren Populationen, die eine Tiefe von unter 5<br />
m erreichen können.<br />
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass <strong>der</strong> Behler<br />
See eine mäßig artenreiche <strong>und</strong> gut entwickelte<br />
submerse Vegetation besitzt, die 14 Arten beinhaltet,<br />
von denen 5 gefährdet beziehungsweise vom<br />
Aussterben bedroht sind. Es erscheint in Anbetracht<br />
<strong>der</strong> großen Tiefenausdehnung <strong>der</strong> Vegetation<br />
ihre Artenzahl etwas reduziert. Obwohl die großflächigen<br />
Armleuchteralgenrasen beson<strong>der</strong>s hervorzuheben<br />
sind, weisen auch bei diesen Arten<br />
an<strong>der</strong>e vergleichbare Gewässer im Raum Plön eine<br />
höhere Artenzahl <strong>und</strong> eine mehr o<strong>der</strong> weniger<br />
deutliche Zonierung auf. Trotz dieser Einschränkungen<br />
ist <strong>der</strong> Erhalt <strong>der</strong> submersen Vegetation<br />
des Behler Sees von landesweiter Bedeutung.<br />
Freiwasser<br />
Der See war durch seine große Tiefe im Sommer<br />
thermisch stabil geschichtet (Abbildung 54).<br />
Im Februar 2002 wurden im Oberflächenwasser<br />
des noch volldurchmischten Sees die Pflanzenhauptnährstoffe<br />
Phosphor in verhältnismäßig hoher<br />
Konzentration (0,095 mg/l Ges.-P) <strong>und</strong> Stickstoff<br />
in niedriger Konzentration (0,99 mg/l Ges.-<br />
N), knapp die Hälfte hiervon als Nitrat (0,49 mg/l<br />
NO3-N), festgestellt (Abbildung 55). Die Ammoniumkonzentration<br />
war mit 0,016 mg/l NH4-N sehr<br />
niedrig.<br />
Im Sommer wurde im oberflächennahen Wasser<br />
eine <strong>für</strong> stabil geschichtete <strong>Seen</strong> typische Nährstoffverknappung<br />
<strong>und</strong> eine Anreicherung über dem<br />
Gr<strong>und</strong> beobachtet. Bis Juli sank die Gesamtphosphor-Konzentration<br />
im Oberflächenwasser auf<br />
0,035 mg/l P. Gelöstes Phosphat (0,012 mg/l PO4-<br />
-P) war zu diesem Zeitpunkt messbar, sonst lag es<br />
unter <strong>der</strong> Bestimmungsgrenze (0,005 mg/l PO4-P).<br />
Über dem Seegr<strong>und</strong> stiegen die Phosphor- <strong>und</strong> die<br />
Phosphat-Konzentrationen kontinuierlich bis auf<br />
0,35 mg/l P-Ges beziehungsweise bis 0,299 mg/l<br />
PO4-P an (Abbildung 56). Im Oberflächenwasser<br />
blieb Nitrat den Sommer über unter <strong>der</strong> Nachweisgrenze<br />
(0,05 NO3-N), war jedoch im Tiefenwasser<br />
vorhanden. Im Juli wurde in 25 m Tiefe ein hoher<br />
Nitratgehalt (0,71 mg/l NO3-N) <strong>und</strong> ein niedriger<br />
Ammoniumgehalt (0,029 mg/l NH4-N) gemessen.<br />
Im September lag die Nitrat-Konzentration nur<br />
noch in 25 m mit 0,181 mg/l im messbaren Bereich.<br />
Dieses lässt Denitrifikationsprozesse vermuten,<br />
bei denen das Nitrat durch Bakterien über<br />
Nitrit zu molekularem Stickstoff umgewandelt <strong>und</strong><br />
an die Atmosphäre abgegeben wird. Höhere Am-