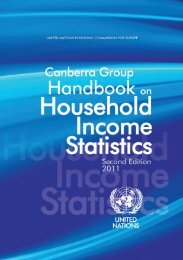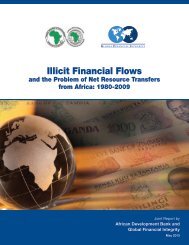econstor
4938_zb_dtindaten_150714_online
4938_zb_dtindaten_150714_online
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Anmerkungen<br />
Spoerer sind hier auch die Arbeiten von Rainer Fremdling und Reiner<br />
Stäglin zu nennen, die eine Kritik und Neuberechnung der Hoffmann’schen<br />
Zahlen der VGR zum Gegenstand haben; vgl. z.B. Rainer<br />
Fremdling/Reiner Stäglin: Die Industrieerhebung von 1936: Ein Input-<br />
Output-Ansatz zur Rekonstruktion der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung<br />
für Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert – ein Arbeitsbericht,<br />
in: Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte,<br />
90 (2003), 4, S. 416 – 428.<br />
14 Maddison (Anm. 3).<br />
15 Brian R. Mitchell: International Historical Statistics. Europe 1750 – 2005,<br />
6. Aufl., New York 2007.<br />
14 Preise<br />
1 Preisangaben unterschiedlicher Währungssysteme sind nicht direkt<br />
miteinander vergleichbar, sie müssen erst in ein bestimmtes<br />
Währungssystem umgerechnet werden.<br />
2 Bei der Gewichtung geht es darum, dass die Güterpreise bei der<br />
Indexberechnung mit einem Faktor multipliziert werden, der der<br />
Bedeutung dieser Güter im Warenkorb des Haushalts entspricht,<br />
wobei sich die Gewichte zu 1 addieren.<br />
3 Für die besonders dramatischen Preisveränderungen während und<br />
unmittelbar nach den beiden Weltkriegen enthalten die Preiskurven in<br />
Abbildung 1 keine Werte. Sie würden das Gesamtbild verzerren.<br />
4 Die Indizes für Ernährung, Wohnung und Bekleidung reichen, neben<br />
Hausrat und Beleuchtung, am weitesten in die Geschichte zurück.<br />
Für Ernährung reichen die amtlichen Werte bis 1881 und für die beiden<br />
anderen Produktgruppen bis 1924 zurück.<br />
5 Ab 1881 repräsentiert der VPI einen Preisindex für Ernährung. Dass<br />
die Werte des VPI nicht mit dem hier verwendeten Index für Nahrungsmittel<br />
übereinstimmen, liegt an den unterschiedlichen Berechnungsweisen.<br />
Der Preisindex für Ernährung wurde vom Statistischen Bundesamt<br />
und der Preisindex für Nahrungsmittel von Walther G. Hoffmann:<br />
Das Wachstum der deutschen Wirtschaft seit der Mitte des 19. Jahrhunderts,<br />
Berlin u.a. 1965 zusammen gestellt.<br />
6 In den 179 Jahren, die der Untersuchungszeitraum dieser Studie<br />
abdeckt, gab es folgende Währungen: 1834 bis 1875 Taler- und Guldenwährung;<br />
1876 bis 1914 (Gold-)Mark; 1914 bis 1923 Mark ohne Golddeckung;<br />
1923 Rentenmark; 1924 bis 1948 Reichsmark (Goldkernwährung),<br />
ab 1924 bestanden Reichsmark und Rentenmark neben -<br />
einander; 1948 bis März 1973 D-Mark auf der Basis fester Wechselkurse<br />
(Bretton-Woods-System); 1973 bis 2002 D-Mark (flexible Wechselkurse);<br />
ab 2002 Euro. Neben diesen Währungsumstellungen haben<br />
sich auch Art und Beschaffenheit des Geldes grundlegend verändert.<br />
Während man sich über viele Jahrzehnte ein wertstabiles Geld ohne<br />
die Bindung an Edelmetalle überhaupt nicht vorstellen konnte, ist das<br />
heutige Geld lediglich noch Fiatgeld, also Geld ohne intrinsischen Wert,<br />
im Gegensatz zum Warengeld.<br />
7 Vor dem Ersten Weltkrieg ist ein kontinuierlicher Lebenshaltungsindex<br />
von den damaligen statistischen Ämtern nicht ermittelt worden. Aus<br />
diesem Grund hat das Statistische Bundesamt im Jahr (1958) für die<br />
Zeit von 1881 bis 1913 aus Aufzeichnungen privater Autoren einen Preisindex<br />
für die Ernährung (1913 =100) berechnet. Dabei handelt es sich<br />
um den Durchschnitt aus 10 Indexziffern, die aus Einzelhandelspreisen<br />
für etwa 10 bis 20 Lebensmittel errechnet wurden. Die Unterlagen beziehen<br />
sich zum Teil auf das Deutsche Reich, zum Teil auf einzelne<br />
Bundesstaaten bzw. Städte.<br />
8 Median = 1,3 Prozent; Mittelwert = 1,8 Prozent; Minimum = – 23 Prozent;<br />
Maximum = + 22 Prozent.<br />
9 Mittelwert = 0,9 Prozent; Median = 1,1 Prozent; Minimum = – 3,7 Prozent;<br />
Maximum = + 6,3 Prozent.<br />
10 Für den Gesamtzeitraum, also von 1924 bis 1948, ergeben sich<br />
folgende Werte: Mittelwert = 2,2 Prozent, Median = 1,8 Prozent,<br />
Minimum = – 11,4 Prozent, Maximum = + 25 Prozent.<br />
11 Von 1834 bis 2013 beträgt das arithmetische Mittel des jährlichen<br />
Preisanstiegs 1,95 Prozent, der Median 1,8 Prozent, wobei in 103<br />
von 167 Jahren die Inflationsrate im Bereich von 0 bis 5 Prozent liegt.<br />
12 Statistisches Bundesamt: Preise. Preise ausgewählter Güter.<br />
1948 – 2002, Wiesbaden (7.3.2013). Die Preise wurden vom Statistischen<br />
Bundesamt als Zwischenergebnis für die Berechnung von Verbraucherpreisindizes<br />
verwendet. Nach 2002 hat das Statistische<br />
Bundesamt diese Preisstatistik nicht weitergeführt. Wir danken Herrn<br />
Thomas Krämer vom Statistischen Bundesamt für die freundliche<br />
Überlassung des Preismaterials.<br />
13 Hoffmann (Anm. 5).<br />
14 Rainer Gömmel: Realeinkommen in Deutschland. Ein internationaler<br />
Vergleich (1810 –1914). Vorträge zur Wirtschaftsgeschichte, Heft 4<br />
(Hrsg.: H. Kellenbenz/J. Schneider), Nürnberg 1979.<br />
15 Jürgen Kuczynski: Die Geschichte der Lage der Arbeiter unter dem<br />
Kapitalismus, Bd. 3, Berlin (Ost) 1962; zitiert nach Bernd Sprenger:<br />
Das Geld der Deutschen. Geldgeschichte Deutschlands von den<br />
Anfängen bis zur Gegenwart, Paderborn u.a. 2002, S. 190.<br />
15 Geld und Kredit<br />
1 Streng genommen tritt der „Finanzierungsfall“ bei Diskrepanzen zwischen<br />
Ausgaben und Einnahmen auf. Gemeint hier ist der „Privatfinanzsektor“:<br />
Wirtschaftssubjekte mit Überschüssen benötigen Anlagemöglichkeiten<br />
als „Speicher“, und „Defizite“ können nicht ohne<br />
Inanspruchnahme von Ersparnissen entstehen (hierzu Richard Tilly:<br />
Geld und Kredit in der Wirtschaftsgeschichte, Stuttgart 2003, S. 15), aber<br />
natürlich kann die Relation auch die öffentlichen Finanzen berühren.<br />
2 Um 1835 gab es vielleicht ca. 400 „Geldhandlungen“ (von denen<br />
wenige Dutzende „Banken“ waren) und dazu noch mehrere Hundert<br />
Sparkassen in Deutschland. Um 1913 wurde die Zahl der Banken und<br />
bankähnlichen Institute auf über 5000 (mit den kleinen ländlichen Kreditgenossenschaften<br />
jedoch über 20 000) geschätzt. Dazu Deutsche<br />
Bundesbank: Deutsches Geld- und Bankwesen in Zahlen 1876 –1975,<br />
Frankfurt a. M., 1976, S. 67.<br />
3 Allerdings würde eine gründliche Fragilitätsanalyse Daten über die<br />
Eigenkapitalquote und die Verteilung unter den einzelnen Banken<br />
voraussetzen.<br />
4 Spezielle „Bodenkreditinstitute“, öffentliche und private Unternehmen,<br />
spielten im 19. Jahrhundert eine dominierende Rolle im Markt für<br />
Grundkredite. Siehe die Reihe „Schuldverschreibungen der Kreditinstitute“<br />
in Tabelle 4.<br />
331