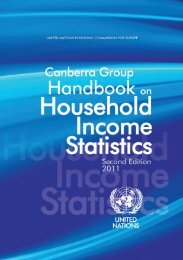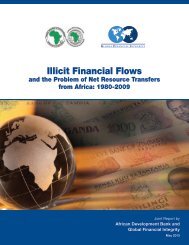Bevölkerung, Haushalte und Familien / Kap 02 Abb. 1: Reallohn, Getreideproduktion und Bevölkerung in Deutschland (1949–90: BRD) u Abb 1 Reallohn, Getreideproduktion und Bevölkerung in Deutschland * 700 500 Reallohn (1913=100) Getreide (100 000 t) Einwohner (Mio.) 300 100 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 D.R. 1.WK WR 2.WK BRD DE * Reallohn: Reihe x0468; Getreideproduktion: Summe aus Weizen- und Roggenproduktion, Reihen x0768 und x0769. tes Abflachen der Reallohnzuwächse – Die nicht mehr evident und werden von den längeren Trends des Sterblichkeits- und vor allem Geburtenrückgangs überlagert. Deutlich wird damit, dass im 18. Jahrhundert Einkommensschwankungen durchaus noch den von Malthus behaupteten Einfluss auf die Geburten (die sogenannten präventiven Hemmnisse) sowie auf die Sterblichkeit hatten (die positiven Hemmnisse). Schon zu Beginn der in diesem Beitrag erfassten Zeit, geschweige denn im späten 20. Jahrhundert, galt das nicht mehr eindeutig. Das kann nicht daran liegen, dass im 19. Jahrhundert gewerbliche Einkommensquellen allmählich wichtiger wurden – das war erst im Kaiser reich der Fall. Entscheidend war vielmehr die Herausbildung von Agrarmärkten, die dafür sorgten, dass lokale Miss ernten durch überlokalen Handel aus geglichen wurden und Einkommen deshalb nicht mehr massiv von Ernteschwankungen beeinflusst wurden (vgl. den u Tab 1, Abb 1, Abb 2 Beitrag von Michael Kopsidis). demografische Transition In vielen Darstellungen wird unter dem „demografischen Übergang“ eine bestimmte regelmäßige Abfolge von Phasen verstanden. Sie führt – weltweit – von einem Zustand hoher Sterbe- und Geburtenraten mit stabiler Bevölkerung über einen zunächst aufgrund des medizinischen Fortschritts einsetzenden Rückgang der Sterblichkeit und deshalb beginnendes Bevölkerungswachstum in eine dritte Phase, in der – weil die Sterberate zuvor gesunken ist und die Eltern nun weniger Geburten brauchen, um überlebende Kinder zu haben – auch die Geburten zurückgehen, bis als vierte Phase ein neues Gleichgewicht erreicht ist. Dieses Vier- Phasen-Modell, das in vielen Schulbüchern steht, ist ein Versuch, einen realen, wichtigen und vor allem unumkehrbaren Wandlungsprozess zu beschreiben. Es bedarf aber in allen vier Bereichen der kritischen Überprüfung. 4 u Tab 2 Erstens gab es vor dem Übergang keinen stabilen Gleichgewichtszustand, sondern es wechselten sich oft längere 41 Millionen Menschen zählte die Bevölkerung laut Volkszählung im Deutschen Reich 1871. 68,3 Millionen waren es 1939. 33
Kap 02 / Bevölkerung, Haushalte und Familien u Tab 2 Geburten und Todesfälle Lebendgeborene Totale Fertilitätsrate * Rohe Geburtenrate ** Anteil der nichtehelich Geborenen Sterbefälle Rohe Sterberate ** Alterslastquotient 65+/15 (25) – 64 Jahre Übersterblichkeit der Männer im Alter von 60 Jahren Mio. Lebendgeburten pro Frau pro 1 000 % Mio. pro 1 000 % Jahre x0066 x0067 x0068 x0069 x0070 x0071 x0072 x0073 Deutscher Bund / Deutsches Reich 1834 1,10 4,88 37,40 – 0,91 30,86 10,29 0,10 1849 1,32 4,80 39,18 11,67 0,96 28,65 9,95 0,03 1895 1,88 – 36,10 8,98 1,15 22,14 8,33 0,78 1913 1,84 3,52 27,45 9,60 1,00 15,00 8,26 – 1919 1,26 – 20,04 11,03 0,98 15,56 8,36 – 1925 1,29 2,21 20,71 11,81 0,74 11,93 8,47 – 1929 1,15 1,93 17,94 12,07 0,81 12,60 10,04 – 1933 0,96 1,58 14,67 10,67 0,73 11,19 11,60 0,96 1937 1,28 2,09 18,83 7,66 0,79 11,71 12,01 – Bundesrepublik 1950 0,81 2,10 16,26 9,73 0,53 10,58 13,81 1,26 1961 1,01 2,45 18,03 5,95 0,63 11,17 – – 1970 0,81 2,02 13,37 5,46 0,73 12,12 20,70 3,75 1980 0,62 1,45 10,09 7,56 0,71 11,60 22,71 4,30 1987 0,64 1,37 10,51 9,71 0,69 11,25 – – 1950 0,30 – 16,53 12,79 0,22 11,94 15,88 1,71 1964 0,29 2,54 17,19 9,42 0,22 13,14 23,52 2,65 1971 0,23 2,13 13,77 15,12 0,23 13,77 25,49 – 1981 0,24 1,85 14,19 25,58 0,23 13,88 23,05 – 1989 0,20 1,56 11,97 33,66 0,21 12,38 19,79 – DDR Deutschland 1990 0,91 1,45 11,40 15,32 0,92 11,60 21,70 4,35 2000 0,77 1,38 9,33 23,41 0,84 10,21 24,55 4,16 2010 0,68 1,39 8,29 33,26 0,86 10,50 27,74 – * Der Begriff der „Totalen“ Fertilitätsrate soll verdeutlichen, dass es sich hierbei um die Summierung der altersspezifischen Fertilitätsraten von Frauen handelt. ** Die Geburten- und Sterberate wird als „roh“ bezeichnet, weil diese Indikatoren die Alters- und Geschlechtszusammensetzung der Bevölkerung nicht berücksichtigen. Phasen von Bevölkerungswachstum (und fallenden Einkommen) mit solchen eines manchmal recht katastrophalen Rückgangs der Bevölkerung ab. Schon im mittleren 19. Jahrhundert lagen die Geburten deutlich über der Sterblichkeit, die Bevölkerung befand sich also – wie schon im 16. oder im 18. Jahrhundert – wieder einmal in einer Wachstumsphase. u Abb 2 Zweitens kam der Sterblichkeitsrückgang nicht überall zuerst, zum Beispiel nicht in Frankreich und den USA. In den USA setzte der Rückgang der Geburten lange vor, in Frankreich gleichzeitig mit dem Rückgang der Sterblichkeit ein. In Deutschland spricht einiges dafür, den Sterblichkeitsrückgang im frühen 19. Jahrhundert zu datieren; welche Rolle der medizinische Fortschritt dabei spielte, wird im Beitrag von Reinhard Spree erörtert. Drittens war der Rückgang der Fruchtbarkeit – in Deutschland in der zweiten Hälfte des Kaiserreichs von etwa fünf auf etwa zwei Geburten pro Frau – durchaus nicht nur eine Reaktion auf den Rückgang der (Kinder-)Sterblichkeit, sondern Teil eines ökonomischen Modernisierungsprozesses, zu dem unter anderem die zunehmende Frauenerwerbstätig keit, bessere Finanzinstitutionen, Schulen, Post, Telegraf, Stimmenanteile progressiver Parteien usw. beitrugen. 5 Viertens wurde aber auch nach dem großen Fruchtbarkeitsrückgang des Kaiserreichs kein neues Gleichgewicht erreicht. Ab 1970 fiel die Kinderzahl in der Bundes- 34
- Page 1 and 2: econstor www.econstor.eu Der Open-A
- Page 4 and 5: Deutschland in Daten Zeitreihen zur
- Page 6 and 7: Inhaltsverzeichnis Einleitung / 5 T
- Page 8 and 9: Einleitung Thomas Rahlf Geschichte
- Page 10 and 11: Einleitung ringer ausfiel als etwa
- Page 12 and 13: Einleitung im Zuge der Reichsgründ
- Page 14 and 15: Einleitung Im Kapitel über Krimina
- Page 16 and 17: Die DDR-Statistik: Probleme und Bes
- Page 18 and 19: Die DDR-Statistik: Probleme und Bes
- Page 20 and 21: Die DDR-Statistik: Probleme und Bes
- Page 22 and 23: Statistische Daten zur historischen
- Page 24 and 25: Umwelt, Klima und Natur / Kap 01 Kl
- Page 26 and 27: Umwelt, Klima und Natur / Kap 01 St
- Page 28 and 29: Abb 3: Minimale Wasserstände - in
- Page 30 and 31: Umwelt, Klima und Natur / Kap 01 u
- Page 32 and 33: Umwelt, Klima und Natur / Kap 01 Da
- Page 34 and 35: Im 19. und 20. Jahrhundert hört da
- Page 38 and 39: Abb. 3: Demografischer Übergang -
- Page 40 and 41: Bevölkerung, Haushalte und Familie
- Page 42 and 43: Bevölkerung, Haushalte und Familie
- Page 44 and 45: Bevölkerung, Haushalte und Familie
- Page 46 and 47: Bevölkerung, Haushalte und Familie
- Page 48 and 49: Bevölkerung, Haushalte und Familie
- Page 50 and 51: Migration bildet seit jeher ein zen
- Page 52 and 53: Migration / Kap 03 u Abb 1 Abwander
- Page 54 and 55: Migration / Kap 03 land bzw. in der
- Page 56 and 57: Migration / Kap 03 u Abb 2 Ausländ
- Page 58 and 59: e Wanderungsbewegungen - in 1000 Mi
- Page 60 and 61: Abb 6: Aussiedler - in Prozent Migr
- Page 62 and 63: Migration / Kap 03 Datengrundlage D
- Page 64 and 65: Bildung ist für Menschen in Deutsc
- Page 66 and 67: Bildung und Wissenschaft / Kap 04 u
- Page 68 and 69: Bildung und Wissenschaft / Kap 04 u
- Page 70 and 71: Bildung und Wissenschaft / Kap 04 u
- Page 72 and 73: Bildung und Wissenschaft / Kap 04 L
- Page 74 and 75: Bildung und Wissenschaft / Kap 04 s
- Page 76 and 77: Bildung und Wissenschaft / Kap 04 G
- Page 78 and 79: Unter dem Begriff „Gesundheitswes
- Page 80 and 81: Gesundheitswesen / Kap 05 gut 42 Ja
- Page 82 and 83: Gesundheitswesen / Kap 05 u Tab 3 G
- Page 84 and 85: Gesundheitswesen / Kap 05 Tab 5 (Au
- Page 86 and 87:
Gesundheitswesen / Kap 05 u Tab 6 M
- Page 88 and 89:
Gesundheitswesen / Kap 05 u Tab 8 M
- Page 90 and 91:
Gesundheitswesen / Kap 05 Datengrun
- Page 92 and 93:
Staatliche Sozialpolitik ist der wi
- Page 94 and 95:
Sozialpolitik / Kap 06 ab 1937 auch
- Page 96 and 97:
Sozialpolitik / Kap 06 versichert w
- Page 98 and 99:
Sozialpolitik / Kap 06 1810 1820 ge
- Page 100 and 101:
Sozialpolitik / Kap 06 Die kriegsbe
- Page 102 and 103:
Sozialpolitik / Kap 06 Leitungsstru
- Page 104 and 105:
Sozialpolitik / Kap 06 Datengrundla
- Page 106 and 107:
In den öffentlichen Finanzen spieg
- Page 108 and 109:
Abb 1: Anteile der Gebietskörpersc
- Page 110 and 111:
Öffentliche Finanzen / Kap 07 die
- Page 112 and 113:
Öffentliche Finanzen / Kap 07 Abb
- Page 114 and 115:
Öffentliche Finanzen / Kap 07 Abb
- Page 116 and 117:
Öffentliche Finanzen / Kap 07 Date
- Page 118 and 119:
Demokratie benötigt politische Bet
- Page 120 and 121:
Politische Partizipation / Kap 08 u
- Page 122 and 123:
Politische Partizipation / Kap 08 c
- Page 124 and 125:
Politische Partizipation / Kap 08 2
- Page 126 and 127:
Politische Partizipation / Kap 08 u
- Page 128 and 129:
Politische Partizipation / Kap 08 u
- Page 130 and 131:
Politische Partizipation / Kap 08 D
- Page 132 and 133:
Politische Partizipation / Kap 08 D
- Page 134 and 135:
Von der Armuts- zur Wohlstandskrimi
- Page 136 and 137:
Kriminalität / Kap 09 Verkehrsdeli
- Page 138 and 139:
Kriminalität / Kap 09 Karl Marx al
- Page 140 and 141:
Kriminalität / Kap 09 bilität geg
- Page 142 and 143:
Kriminalität / Kap 09 u Tab 4 Sank
- Page 144 and 145:
Kriminalität / Kap 09 Datengrundla
- Page 146 and 147:
In modernen Marktgesellschaften bed
- Page 148 and 149:
Arbeit, Einkommen und Lebensstandar
- Page 150 and 151:
Arbeit, Einkommen und Lebensstandar
- Page 152 and 153:
Arbeit, Einkommen und Lebensstandar
- Page 154 and 155:
Arbeit, Einkommen und Lebensstandar
- Page 156 and 157:
Arbeit, Einkommen und Lebensstandar
- Page 158 and 159:
Das Kapitel zu Kultur, Freizeit und
- Page 160 and 161:
Kultur, Tourismus und Sport / Kap 1
- Page 162 and 163:
Kultur, Tourismus und Sport / Kap 1
- Page 164 and 165:
Kultur, Tourismus und Sport / Kap 1
- Page 166 and 167:
Kultur, Tourismus und Sport / Kap 1
- Page 168 and 169:
Kultur, Tourismus und Sport / Kap 1
- Page 170 and 171:
Kultur, Tourismus und Sport / Kap 1
- Page 172 and 173:
Kultur, Tourismus und Sport / Kap 1
- Page 174 and 175:
Kultur, Tourismus und Sport / Kap 1
- Page 176 and 177:
Religion spielt in der Geschichte d
- Page 178 and 179:
Religion / Kap 12 noch die größte
- Page 180 and 181:
Religion / Kap 12 Zeit um 1970 und
- Page 182 and 183:
Religion / Kap 12 führten dazu, da
- Page 184 and 185:
D.R. 1.WK WR 2.WK BRD DE Religion /
- Page 186 and 187:
Religion / Kap 12 durch die Nachfra
- Page 188 and 189:
Religion / Kap 12 nes neureligiöse
- Page 190 and 191:
Der Beitrag behandelt die wirtschaf
- Page 192 and 193:
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung
- Page 194 and 195:
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung
- Page 196 and 197:
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung
- Page 198 and 199:
Abb 3a: Wertschöpfung Volkswirtsch
- Page 200 and 201:
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung
- Page 202 and 203:
Abb 6: Die prozentualen Anteile der
- Page 204 and 205:
Der Beitrag behandelt Preisentwickl
- Page 206 and 207:
Abb 1: Preise ausgewählter Konsumg
- Page 208 and 209:
Preise / Kap 14 u Tab 3 Durchschnit
- Page 210 and 211:
Preise / Kap 14 Abb 3: Ausgewählte
- Page 212 and 213:
- 40 Preise / Kap 14 u Abb 4 Verbra
- Page 214 and 215:
Preise / Kap 14 Auch die Periode na
- Page 216 and 217:
Geld und Kredit sind schon seit der
- Page 218 and 219:
Geld und Kredit / Kap 15 Die Geldme
- Page 220 and 221:
60 Geld und Kredit / Kap 15 20 1810
- Page 222 and 223:
Abb 6: Umlauf von Schuldverschreibu
- Page 224 and 225:
Geld und Kredit / Kap 15 wie auch d
- Page 226 and 227:
Geld und Kredit / Kap 15 Datengrund
- Page 228 and 229:
Die Geschichte des 19. und des 20.
- Page 230 and 231:
Verkehr und Kommunikation / Kap 16
- Page 232 and 233:
Verkehr und Kommunikation / Kap 16
- Page 234 and 235:
Verkehr und Kommunikation / Kap 16
- Page 236 and 237:
Verkehr und Kommunikation / Kap 16
- Page 238 and 239:
Verkehr und Kommunikation / Kap 16
- Page 240 and 241:
Der Durchbruch zu einem von Produkt
- Page 242 and 243:
Landwirtschaft / Kap 17 Zweiten Wel
- Page 244 and 245:
Landwirtschaft / Kap 17 u Tab 1 Lan
- Page 246 and 247:
Landwirtschaft / Kap 17 10 000 1820
- Page 248 and 249:
Landwirtschaft / Kap 17 Kali bei 65
- Page 250 and 251:
Landwirtschaft / Kap 17 u Tab 4 Arb
- Page 252 and 253:
Landwirtschaft / Kap 17 Datengrundl
- Page 254 and 255:
Heute hat Deutschland so viele Unte
- Page 256 and 257:
Unternehmen, Industrie und Handwerk
- Page 258 and 259:
Unternehmen, Industrie und Handwerk
- Page 260 and 261:
Unternehmen, Industrie und Handwerk
- Page 262 and 263:
Unternehmen, Industrie und Handwerk
- Page 264 and 265:
Unternehmen, Industrie und Handwerk
- Page 266 and 267:
Unternehmen, Industrie und Handwerk
- Page 268 and 269:
Unternehmen, Industrie und Handwerk
- Page 270 and 271:
Bauen und Wohnen dienen grundlegend
- Page 272 and 273:
Bauen und Wohnen / Kap 19 Die Situa
- Page 274 and 275:
Bauen und Wohnen / Kap 19 1820 Abb
- Page 276 and 277:
Bauen und Wohnen / Kap 19 1880 Abb.
- Page 278 and 279:
Bauen und Wohnen / Kap 19 Datengrun
- Page 280 and 281:
Die deutsche Wirtschaft erlebte sei
- Page 282 and 283:
Binnenhandel und Außenhandel / Kap
- Page 284 and 285:
Binnenhandel und Außenhandel / Kap
- Page 286 and 287:
Binnenhandel und Außenhandel / Kap
- Page 288 and 289:
Binnenhandel und Außenhandel / Kap
- Page 290 and 291:
Binnenhandel und Außenhandel / Kap
- Page 292 and 293:
Binnenhandel und Außenhandel / Kap
- Page 294 and 295:
Binnenhandel und Außenhandel / Kap
- Page 296 and 297:
Die Zahlungsbilanz spiegelt Deutsch
- Page 298 and 299:
Zahlungsbilanz / Kap 21 u Abb 1 Sal
- Page 300 and 301:
Zahlungsbilanz / Kap 21 in den 1960
- Page 302 and 303:
Zahlungsbilanz / Kap 21 u Tab 2 Tei
- Page 304 and 305:
Zahlungsbilanz / Kap 21 Vor zeichen
- Page 306 and 307:
Zahlungsbilanz / Kap 21 Datengrundl
- Page 308 and 309:
Wie entwickelte sich die deutsche V
- Page 310 and 311:
Internationale Vergleiche / Kap 22
- Page 312 and 313:
Internationale Vergleiche / Kap 22
- Page 314 and 315:
Internationale Vergleiche / Kap 22
- Page 316 and 317:
Internationale Vergleiche / Kap 22
- Page 318 and 319:
Internationale Vergleiche / Kap 22
- Page 320 and 321:
Internationale Vergleiche / Kap 22
- Page 322 and 323:
Internationale Vergleiche / Kap 22
- Page 324 and 325:
Anmerkungen 17 Grundlegend bereits
- Page 326 and 327:
Anmerkungen schutz und Reaktorsiche
- Page 328 and 329:
Anmerkungen Statistisches Bundesamt
- Page 330 and 331:
Anmerkungen 4 Vgl. Statistisches Re
- Page 332 and 333:
Anmerkungen 13 Rainer Metz: Säkula
- Page 334 and 335:
Anmerkungen Spoerer sind hier auch
- Page 336 and 337:
Anmerkungen 19 Andreas Kunz: Statis
- Page 338 and 339:
Anmerkungen 7 Hierbei haben wir die
- Page 341:
Wie hoch? Wie groß? Wie viele? Mit