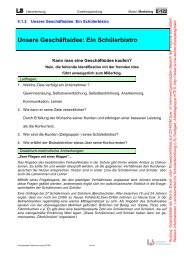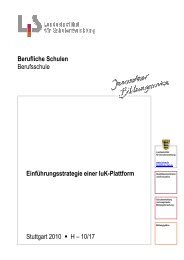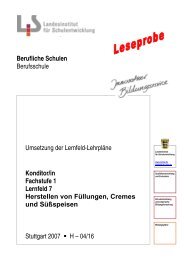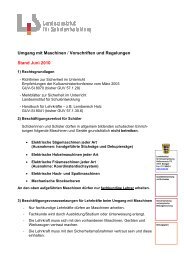Argumentieren und Erörtern im Fach Deutsch - Landesinstitut für ...
Argumentieren und Erörtern im Fach Deutsch - Landesinstitut für ...
Argumentieren und Erörtern im Fach Deutsch - Landesinstitut für ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Landesinstitut</strong> <strong>für</strong> Schulentwicklung<br />
Bei dem zweiten Merkmal der pädagogischen Diagnostik 13 geht es um die<br />
kontinuierliche Reflexion der <strong>im</strong> Unterricht von den Schülerinnen <strong>und</strong> Schülern<br />
gezeigten Leistungen. Im Idealfall wird klar, welchen Entwicklungsstand<br />
der einzelne Lernende erreicht hat <strong>und</strong> über welche Entwicklungspotentiale er<br />
verfügt. Diese Form von Diagnose findet allerdings begleitend <strong>im</strong> Zuge der<br />
Unterrichtsgestaltung ohne den Anspruch einer wissenschaftlichen Basis statt.<br />
Zur diagnostischen Kompetenz der Lehrpersonen gehört das Beobachten, Beschreiben<br />
<strong>und</strong> Bewerten der Unterrichtsergebnisse 14 . Im Sinne einer Prozessdiagnostik<br />
15 sollten sich die Beobachtungen nicht nur auf die Auswertung von<br />
Unterrichtsprodukten beschränken, sondern auch den Lernverlauf <strong>und</strong> seine<br />
künftigen Gestaltungsmöglichkeiten berücksichtigen.<br />
Bei dieser Einschätzung werden die Lehrpersonen außerdem auf die jeweilige<br />
Bezugsnorm achten, nämlich auf die soziale <strong>und</strong> individuelle Zusammensetzung<br />
ihrer Klasse sowie auf die <strong>im</strong> Zusammenhang der jeweiligen<br />
Unterrichtseinheit <strong>im</strong> Vordergr<strong>und</strong> stehenden Kriterien. Im Unterschied zu<br />
Rückmeldungen, die von einer absoluten Bezugsnorm ausgehen, wie den Vergleichsarbeiten<br />
oder der zentralen Reifeprüfung, ist es <strong>für</strong> die einzelne Lehrkraft<br />
wichtig, bei ihrer Diagnostik die jeweilige soziale Zusammensetzung der Klasse<br />
zu berücksichtigen, also ob es sich um eine Klasse in einer kleinstädtischen Umgebung<br />
mit einer relativ geringen gymnasialen Übergangsquote oder um eine<br />
Klasse in einer Universitätsstadt oder Großstadt handelt. Weiterhin ist es <strong>für</strong><br />
die einzelne Lehrkraft wichtig, auch individuelle Rückmeldungen geben zu können,<br />
auch wenn dies <strong>im</strong> Extremfall bedeuten kann, dass trotz einer deutlichen<br />
relativen Leistungssteigerung sich dies noch nicht in einer Verbesserung der<br />
Note niederschlägt („Du hast nicht mehr 40 Zeichensetzungsfehler gemacht,<br />
sondern nur noch 20.“). Schließlich soll durch transparent aufgestellte Kriterien<br />
<strong>für</strong> den jeweiligen Kompetenzbereich eine Möglichkeit zur Selbst- oder auch<br />
Peer-Einschätzung angeboten werden, durch die der einzelne Lernende nicht<br />
nur sein momentan erreichtes Niveau erkennen, sondern <strong>im</strong> Idealfall auch zugleich<br />
Anregungen <strong>für</strong> eine weitere Verbesserung, Vertiefung oder Erweiterung<br />
erhalten kann.<br />
Von der pädagogischen Diagnostik ist die Unterrichtsdiagnostik zu unterscheiden,<br />
zu der die gegenseitige Hospitation <strong>im</strong> Unterricht, aber auch die Unterrichtsberatung<br />
bzw. -beurteilung bei Besuchen <strong>im</strong> Rahmen einer externen<br />
Evaluation gehören, sowie die pädagogisch-psychologische Diagnostik, bei der<br />
durch einen Psychologen oder eine andere ausgebildete <strong>Fach</strong>kraft mit Hilfe von<br />
auf empirischer Gr<strong>und</strong>lage erstellten Testverfahren bei einem einzelnen Kind<br />
ohne Zeitdruck mögliche Entwicklungsbeeinträchtigungen festgestellt werden,<br />
zum Beispiel eine Lese-Rechtschreib-Schwäche. Allerdings sollte auch die pädagogische<br />
Diagnostik nicht zufällig, sondern systematisch <strong>und</strong> kriterienorientiert<br />
vorgenommen werden. Da langfristige Lernprozesse sehr komplex sind, kann<br />
mit der Diagnostik <strong>im</strong> Alltagsunterricht <strong>im</strong>mer nur ein Teilbereich erfasst werden,<br />
<strong>und</strong> das in der Regel auch nicht exakt. Hinzu tritt noch eine gewisse Unschärfe<br />
durch subjektive Voreingenommenheit, dadurch dass man seine Klasse leicht<br />
über- oder auch unterschätzt. Jede Lehrkraft sollte sich diese Grenzen bewusst<br />
machen. Dann ist die Gefahr, sich einerseits zu überfordern <strong>und</strong> andererseits<br />
die Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler durch zu enge Maßstäbe zu gängeln, weniger<br />
13 Der Begriff wird in der Verwaltungsvorschrift vom 22.08.2008 verbindlich eingeführt.<br />
14 Vgl. dazu Lernen <strong>im</strong> Fokus der Kompetenzorientierung – Individuelles Fördern in der Schule<br />
durch Beobachten – Beschreiben – Bewerten – Begleiten. <strong>Landesinstitut</strong> <strong>für</strong> Schulentwicklung.<br />
Stuttgart 2009, S. 15.<br />
15 Vgl. Marianne Horstkemper: Fördern heißt diagnostizieren. In: Friedrich Jahresheft 2006<br />
Diagnostizieren <strong>und</strong> Fördern, S. 4−7.<br />
Pädagogische Diagnostik<br />
Bezugsnormen<br />
13