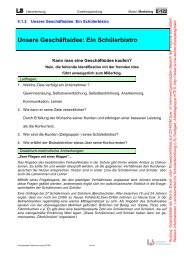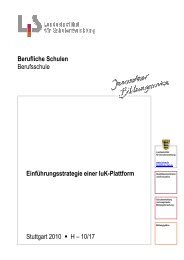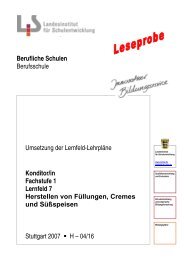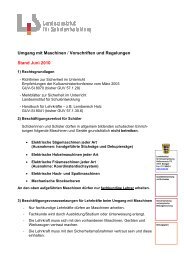Argumentieren und Erörtern im Fach Deutsch - Landesinstitut für ...
Argumentieren und Erörtern im Fach Deutsch - Landesinstitut für ...
Argumentieren und Erörtern im Fach Deutsch - Landesinstitut für ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Landesinstitut</strong> <strong>für</strong> Schulentwicklung<br />
<strong>und</strong> -durchführung. Daraus lässt sich auch ableiten, dass eine konzentrierte Arbeitsatmosphäre<br />
mit großer Schülerbeteiligung herrschen soll. Zum guten Unterricht<br />
gehören also auch Anstrengungen <strong>und</strong> das oft verpönte Üben. Da aber<br />
jeder Lernende seine eigene Art der Informationsaufnahme <strong>und</strong> –verarbeitung<br />
hat, muss das Üben mit vielen Varianten angeboten werden, damit jeder auf<br />
dem <strong>für</strong> ihn am besten geeigneten Weg zum Ziel findet.<br />
Alle diese Merkmale guten Unterrichts finden sich auch in den Übersichten<br />
von Hilbert Meyer 6 , Andreas Helmke <strong>und</strong> Hans Haenisch 7 , die in den letzten<br />
Jahren die größte Resonanz bewirkten. Die drei Autoren betonen den Aspekt<br />
der Schülerorientierung <strong>und</strong> verweisen auf die Bedeutung der individuellen<br />
Förderung durch intelligente <strong>und</strong> variationsreiche Übungs- <strong>und</strong> Wiederholungsphasen.<br />
Weiterhin ist ihnen wichtig, dass das systematisch Gelernte in lebenspraktische<br />
Situationen eingeb<strong>und</strong>en wird, also auch <strong>im</strong> Sinne einer Handlungsorientierung<br />
angewendet werden kann.<br />
Der bekannte Göttinger Neurobiologe Gerald Hüther fasst seine Vorstellung<br />
von einer hochlernwirksamen Unterrichtsgestaltung mit nur drei Bedingungen<br />
zusammen 8 . Ausgangspunkt seiner Überlegungen ist die Frage, wie man das<br />
Gehirn von älteren Menschen opt<strong>im</strong>al trainieren könne. Er verwirft die vielen<br />
angebotenen Gehirn-Jogging-Programme als ungeeignet, da sie von der veralteten<br />
Vorstellung ausgingen, dass das Gehirn eine Art Muskel sei, den man wie<br />
in einem Fitnessstudio am besten durch diverse Anspannungs<strong>im</strong>pulse stärken<br />
könne. Nach den letzten Forschungserkenntnissen sei das Gehirn ein perfekter<br />
Lösungsapparat <strong>für</strong> komplexe, neue Probleme. Und der Lerneffekt sei dann<br />
besonders groß, wenn die zu bewältigende Aufgabe mit einer starken emotionalen<br />
Betroffenheit verb<strong>und</strong>en sei, wenn einem das Problem sozusagen „unter<br />
die Haut“ gehe. Insofern sei die beste lernförderliche Anregung <strong>für</strong> ältere Menschen,<br />
wenn sie in regelmäßigen, aber wohldosierten Zeiten Kinder betreuten.<br />
Bei jeder Art von Problemen, mit denen wir uns konfrontiert sehen, sei es allerdings<br />
wichtig, dass man die Anforderungen bewältigen könne, sonst komme<br />
es zu keinem Erfolgserlebnis. Dazu müsse man mit einer entsprechenden inneren<br />
Einstellung auf die Probleme zugehen, denn wer sich der Herausforderung<br />
einer neuen Aufgabe nicht bewusst <strong>und</strong> offen stelle, der werde auch nichts<br />
lernen. In der psychologischen <strong>Fach</strong>literatur wird dieser Bereich der inneren<br />
Haltung der volitionale Aspekt genannt. In der Schule handelt es sich dabei um<br />
eine Variable, die die Lernenden weitgehend unabhängig vom Unterricht mitbringen<br />
<strong>und</strong> die höchstens langfristig durch viele kleine positive Erfahrungen<br />
<strong>im</strong> Verlaufe der Lernbiographie von der Schule als Institution beeinflusst werden<br />
kann.<br />
Auf die Schule bezogen nennt Hüther drei Gütemerkmale <strong>für</strong> lernwirksame<br />
Probleme: Verstehbarkeit, Sinnhaftigkeit <strong>und</strong> Gestaltbarkeit. Die gestellten Aufgaben<br />
müssen <strong>für</strong> die Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler lösbar sein, d. h. sie müssen<br />
passgenau gestellt werden <strong>und</strong> dürfen weder über- noch unterfordern. Daraus<br />
lässt sich die Forderung nach einer Binnendifferenzierung ableiten. Die gestellten<br />
Aufgaben müssen <strong>für</strong> die Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler sinnvoll sein. Damit wird<br />
der Aspekt der Motivation angesprochen. Insbesondere problemorientierte Aufgaben,<br />
die in einen größeren Kontext eingeb<strong>und</strong>en sind <strong>und</strong> ein entdeckendes<br />
Lernen ermöglichen, das sich an dem altersgemäßen Horizont der Lernenden<br />
orientiert, können diese Bedingung erfüllen. Zwar geht es be<strong>im</strong> lebensprak-<br />
6 Hilbert Meyer: Was ist guter Unterricht? Berlin 2008.<br />
7 Friedrich Jahresheft 2007: Guter Unterricht, S. 64.<br />
8 Hüther, Gerald: Wie man sein Gehirn opt<strong>im</strong>al nutzt. Vortrag auf dem Kongress „Die Kraft von<br />
Imaginationen <strong>und</strong> Visionen“ in Heidelberg. Mai 2008. Vgl. ebenfalls Gerald Hüther: Männer.<br />
Das schwache Geschlecht <strong>und</strong> sein Gehirn. Göttingen 2009, S. 59 <strong>und</strong> S. 64.<br />
Variantenreiches Üben<br />
Schüler- <strong>und</strong><br />
Handlungsorientierung<br />
Drei Lernbedingungen<br />
Passgenaue Aufgaben<br />
Problemorientierte<br />
Aufgaben<br />
9