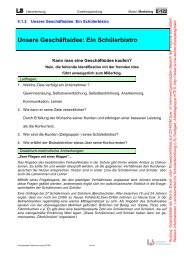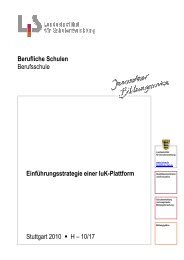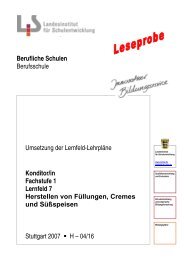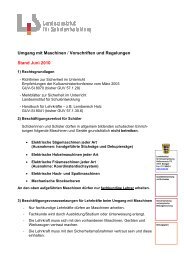Argumentieren und Erörtern im Fach Deutsch - Landesinstitut für ...
Argumentieren und Erörtern im Fach Deutsch - Landesinstitut für ...
Argumentieren und Erörtern im Fach Deutsch - Landesinstitut für ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Landesinstitut</strong> <strong>für</strong> Schulentwicklung<br />
dass Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler ihre Fehler als produktive Chance erkennen<br />
<strong>und</strong> sich auf der Ebene der Metakognition aktiv an der Auswertung der Unterrichtsergebnisse<br />
beteiligen. Wenn es tendenziell gelingen könnte, insbesondere<br />
auch Diagnoseaufgaben in Richtung einer Stärkenorientierung zu erstellen,<br />
ließe sich die Bereitschaft, Mitverantwortung <strong>für</strong> einen erfolgreichen Unterrichtsverlauf<br />
zu übernehmen, wahrscheinlich noch deutlich verbessern.<br />
Diagnose <strong>und</strong> daraus sich ergebende Übungsphasen bilden den Prozess der<br />
„4-B-Förderspirale“ 9 ab. Zur Diagnosephase zählen die drei Schritte des Beobachtens,<br />
Beschreibens <strong>und</strong> Bewertens. Da sich eine Kompetenz selber nicht<br />
direkt erkennen lässt, geht es be<strong>im</strong> Beobachten um die Wahrnehmung der Performanz.<br />
Zum Beschreiben gehört die Dokumentation der Performanz. Durch<br />
das Bewerten der Diagnoseergebnisse sollen der Lernstand der Schülerinnen<br />
<strong>und</strong> Schüler analysiert werden, woraus sich dann möglichst passgenaue Zielbest<strong>im</strong>mungen<br />
<strong>für</strong> die anschließende Phase des differenzierenden Übens ergeben.<br />
Wie bereits erwähnt sollten die Lernenden bei der Auswertung aktiv<br />
einbezogen werden. Das Feedback sollte informierend <strong>und</strong> wertschätzend sein,<br />
auch wenn es um mögliche aufgedeckte Defizite geht. Nach der Erstellung eines<br />
geeigneten Angebots von Lernaufgaben steht <strong>für</strong> die Lehrkraft in der Phase des<br />
intensiven Trainings an den jeweiligen Teilkompetenzen vor allem das Begleiten<br />
<strong>und</strong> Unterstützen der Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler <strong>im</strong> Vordergr<strong>und</strong>.<br />
Hochwirksame Lernaufgaben sollten intelligente Übungen 10 ohne Drillcharakter<br />
anbieten <strong>und</strong> das Interesse der Lernenden durch eine ansprechende kognitive<br />
Aktivierung wecken, <strong>und</strong> zwar auf allen Niveaustufen. Dazu gehört auch<br />
eine entsprechende Ergebnisoffenheit <strong>im</strong> Sinne von variablen <strong>und</strong> kreativen<br />
Lösungsmöglichkeiten. Die Aufgaben sollten den Erwerb <strong>und</strong> die Entwicklung<br />
von Teilkompetenzen zum Ziel haben. Um einen individuellen Lernfortschritt zu<br />
ermöglichen, müssen die Aufgaben auf unterschiedlichen Niveaus formuliert<br />
werden <strong>und</strong> sich an den Kompetenzstufen orientieren, über die die Schülerinnen<br />
<strong>und</strong> Schüler verfügen, d. h. sie gehen von den jeweiligen Stärken aus<br />
<strong>und</strong> vermeiden Über- bzw. Unterforderung. So ist auch die Wahrscheinlichkeit<br />
eines Erfolgserlebnisses bei entsprechender vorauszusetzender individueller<br />
Einsatzbereitschaft relativ hoch. Durch die Aufgaben soll also nicht nur Wissen<br />
vermittelt werden. Es geht auch um Fähigkeiten <strong>und</strong> Einstellungen, die die<br />
Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler in die Lage versetzen, zukünftige Anforderungssituationen<br />
angemessen zu bewältigen.<br />
Um eine Individualisierung <strong>im</strong> Normalunterricht realisieren zu können,<br />
reicht es in der Regel aus, eine Differenzierung in drei Stufen vorzunehmen,<br />
so wie es die Niveaukonkretisierungen in Anlehnung an den europäischen Referenzrahmen<br />
<strong>für</strong> den Fremdsprachenerwerb vorschlagen. Dabei entsprechen<br />
das A-Niveau der niedrigsten <strong>und</strong> das C-Niveau der höchsten Performanzstufe<br />
des jeweiligen Standards. Hilbert Meyer definiert die drei Stufen mit ihrem<br />
jeweiligen intellektuellen Anspruchsniveau folgendermaßen 11 : Be<strong>im</strong> Mindeststandard<br />
(Stufe A) biete sich ein Denken <strong>und</strong> Handeln nach Vorschrift an, be<strong>im</strong><br />
Regelstandard (Stufe B) gehe es um ein Denken <strong>und</strong> Handeln nach Einsicht<br />
<strong>und</strong> be<strong>im</strong> Expertenstandard (Stufe C) dürfe man ein selbstreguliertes Handeln<br />
erwarten. Diese Beschreibung enthält bereits deutliche Anregungen, wie man<br />
eine einzelne Aufgabenidee ganz unterschiedlich der jeweiligen Niveaustufe<br />
entsprechend ausarbeiten kann. Für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler auf der Stufe<br />
9 Lernen <strong>im</strong> Fokus der Kompetenzorientierung. Individuelles Fördern in der Schule durch<br />
Beobachten – Beschreiben – Bewerten – Begleiten. <strong>Landesinstitut</strong> <strong>für</strong> Schulentwicklung<br />
Stuttgart 2009.<br />
10 Vgl. Annemarie von der Groeben: Verschiedenheit nutzen. Berlin 2008. S. 136.<br />
11 Meyer, Hilbert: Was ist Kompetenzorientierung. Interview in: Schulmanagement 6 (2010), S. 25.<br />
Benotungsfreie Zeiten<br />
4-B-Förderspirale<br />
Beobachten<br />
Beschreiben<br />
Bewerten<br />
Begleiten<br />
Kognitive Aktivierung<br />
Ergebnisoffenheit<br />
Keine Über- bzw.<br />
Unterforderung<br />
Individualisierung<br />
23