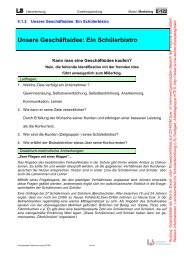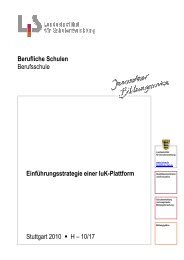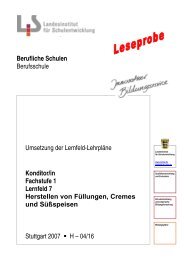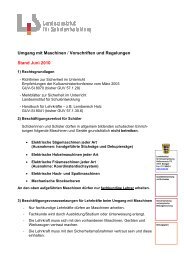Argumentieren und Erörtern im Fach Deutsch - Landesinstitut für ...
Argumentieren und Erörtern im Fach Deutsch - Landesinstitut für ...
Argumentieren und Erörtern im Fach Deutsch - Landesinstitut für ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Landesinstitut</strong> <strong>für</strong> Schulentwicklung<br />
Trainingsbedarf zu best<strong>im</strong>men. Denn <strong>im</strong> Vergleich zur Lernbedarfsdiagnose<br />
am Anfang der Unterrichtseinheit ist das Hauptziel der Zwischendiagnose, den<br />
Stand des einzelnen Lernenden herauszufinden, um daraus in Phase VI möglichst<br />
passgenaue Trainingsaufgaben <strong>im</strong> Sinne der Wiederholung, Erweiterung<br />
<strong>und</strong> Vertiefung abzuleiten.<br />
Bei den differenzierenden Aufgaben in der Trainingsphase wird von drei Niveaustufen<br />
<strong>für</strong> jede Teilkompetenz ausgegangen, so wie es auch bei den Niveaukonkretisierungen<br />
5 , die verbindlich den Bildungsplan ergänzen, der Fall<br />
ist. Dabei entspricht die Niveaustufe A dem Mindeststandard, also der Basis,<br />
die nach Möglichkeit jeder Lernende erreichen sollte. Die Stufe B entspricht<br />
dem Regelstandard, der in Baden-Württemberg die Gr<strong>und</strong>lage <strong>für</strong> die Standarddefinitionen<br />
<strong>im</strong> Bildungsplan abgibt. Die Stufe C schließlich entspricht<br />
dem Expertenstandard <strong>und</strong> umfasst eine deutlich über dem Begabungs- <strong>und</strong><br />
Altersdurchschnitt liegende Realisierung der jeweiligen Teilkompetenz. Diese<br />
Einstufung orientiert sich am europäischen Referenzrahmen <strong>für</strong> den Fremdsprachenerwerb.<br />
Erst nach einer intensiven Trainingsphase schließt die kompetenzorientierte<br />
Unterrichtseinheit mit einer Klassenarbeit ab, deren Ergebnisse<br />
dann <strong>im</strong> Sinne einer vernetzten Jahresplanung <strong>und</strong> einer transparenten Evaluation<br />
in den nächsten Unterrichtseinheiten berücksichtigt <strong>und</strong> fortgeführt werden<br />
sollten.<br />
Bei der Eingangsdiagnose wäre auch der Bef<strong>und</strong> denkbar, dass die <strong>für</strong> die<br />
geplante Unterrichtseinheit zugr<strong>und</strong>e gelegten wesentlichen Teilkompetenzen<br />
in der Lerngruppe gar nicht oder nicht <strong>im</strong> notwendigen Maße beherrscht werden.<br />
Für diesen Fall müsste mit der Variante einer Unterrichtseinheit zur Wiederholung<br />
<strong>und</strong> Vertiefung operiert werden (vergleiche Abbildung 4). Dabei<br />
würde die Phase der Neueinführung zurückgestellt werden zugunsten eines<br />
intensiven Trainings der aufgr<strong>und</strong> der Eingangsdiagnose noch nicht genügend<br />
entwickelten Teilkompetenzen. Erst nach einer Zwischendiagnose, die überprüft,<br />
ob die notwendigen Teilkompetenzen von den meisten Schülerinnen <strong>und</strong><br />
Schülern wenigstens auf dem Niveau des Mindeststandards beherrscht werden,<br />
könnte man dann mit der neuen Einheit beginnen, also den Unterricht mit<br />
der Phase IV der kompetenzorientierten Unterrichtseinheit fortsetzen.<br />
Die beiden beschriebenen Unterrichtseinheiten versuchen auch die <strong>für</strong><br />
nachhaltiges Lernen notwendige „st<strong>im</strong>mige Balance zwischen Eigenzeit <strong>und</strong><br />
Systemzeit“ 6 herzustellen, indem die Lernenden während der Trainingsphasen<br />
gemäß ihrem individuellen Tempo üben können. Dies benötigt allerdings mehr<br />
Unterrichtszeit als der herkömmliche Unterricht, der die zu behandelnden Inhalte<br />
nach <strong>und</strong> nach abarbeitet. Aber bei einem rein inhaltlich orientierten Unterrichtskonzept<br />
besteht <strong>im</strong>mer die Gefahr, dass der Unterricht an einem Teil der<br />
Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler vorbei läuft. „Kriterium <strong>für</strong> eine sinnvolle Nutzung<br />
der Ressource Zeit sind nicht die vermittelten Wissensmengen, sondern die Art<br />
<strong>und</strong> Intensität der Lern- <strong>und</strong> Verstehensprozesse.“ 7 Wenn auch bei einem ganz<br />
bewusst schülerorientierten, also kompetenzorientierten Vorgehen keine Gewähr<br />
da<strong>für</strong> besteht, dass man alle Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler mitnehmen kann,<br />
weil dies ja auch von unterrichtsexternen Faktoren, insbesondere dem volitionalen<br />
Bereich abhängt, so darf man sich doch eine nachhaltigere Wirkung der<br />
Unterrichtsergebnisse erhoffen. Wenn dies so wäre, dann könnte man mittel-<br />
<strong>und</strong> langfristig die zunächst investierte Mehrzeit wieder einholen, insbesondere<br />
bei einer vernetzten Jahresplanung <strong>und</strong> Kooperationen auf <strong>Fach</strong>schafts- oder<br />
5 www.bildung-staerkt-menschen.de/service/downloads/Niveaukonkretisierung/<br />
6 Annemarie von der Groeben: Verschiedenheit nutzen. Besser lernen in heterogenen Gruppen.<br />
Berlin 2008, S. 33.<br />
7 Ebenda S. 34.<br />
Trainingsphase<br />
Mindeststandard<br />
Regelstandard<br />
Expertenstandard<br />
Unterrichtseinheit<br />
zur Wiederholung <strong>und</strong><br />
Vertiefung<br />
Üben gemäss dem<br />
individuellen Tempo<br />
21